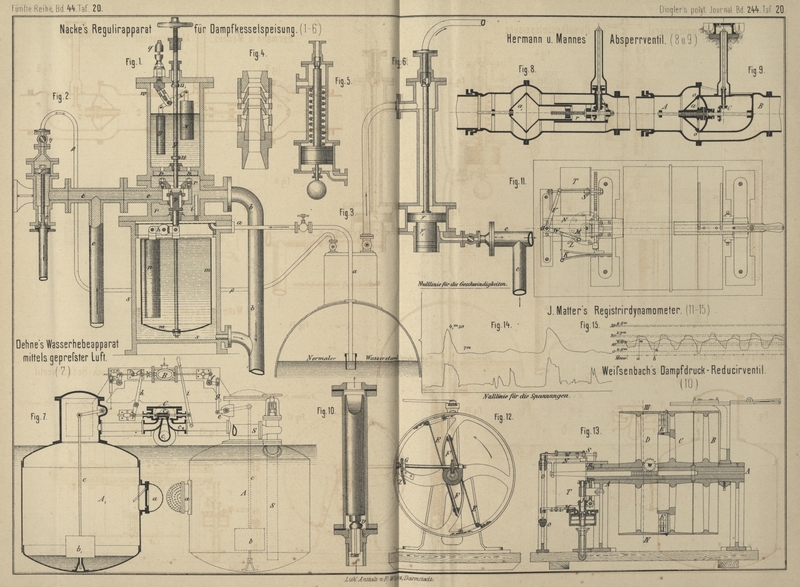| Titel: | J. Matter's Registrir-Dynamometer. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 286 |
| Download: | XML |
J. Matter's Registrir-Dynamometer.
Mit Abbildungen auf Tafel 20.
J. Matter's Registrir-Dynamometer.
Dieser von J. Matter (vom Hause Dollfus-Mieg und Comp.) construirte und durch Fig. 11 bis
13 Taf. 20 nach dem Bulletin de Mulhouse, 1881 Bd. 51 S.
433 veranschaulichte Apparat verzeichnet sowohl die Spannung, wie auch
die Geschwindigkeit eines eine Arbeitsmaschine treibenden Riemens und gestattet
auſserdem, den Arbeitsverbrauch (das Product aus Spannung und Geschwindigkeit) in
jedem Augenblicke direct abzulesen.
Eine hohle Welle A, in zwei Ständern gelagert, trägt 3
Riemenscheiben. Der von der Transmission kommende Riemen wird auf die Scheibe C bezieh. auf die Leerscheibe B gelegt, während die Scheibe D durch einen
Riemen mit der zu untersuchenden Arbeitsmaschine verbunden wird. Die Scheibe C überträgt die Bewegung auf D durch zwei Blattfedern E, welche sich dabei
auf Leitbögen F auflegen. Die Form dieser Körper F ist auf empirischem Wege derart bestimmt, daſs die
relative Drehung der Scheiben C und D gegen einander proportional der zu übertragenden
Umfangskraft, d.h. der Differenz der Spannungen im führenden und im geführten
Riementrum ist. Durch eine an C befestigte Zahnstange
Z, in welche ein Getriebe G eingreift, wird die relative Drehung von D
gegen C auf eine in D
gelagerte Welle und von dieser durch ein zweites Getriebe auf eine in der Hohlwelle
A steckende, mit Kämmen versehene Spindel
übertragen, und zwar muſs die achsiale Verschiebung dieser Spindel proportional der
relativen Drehung, folglich auch der Umfangskraft sein. An dem aus A hervorstehenden Theil der Spindel ist ein (in der
Zeichnung nicht sichtbarer) Schreibstift angebracht, welcher die Verschiebung direct
auf die langsam sich drehende Trommel T
aufzeichnet.
Zur Messung der Geschwindigkeit ist ein hydraulisches Tachometer benutzt. Von der
Welle A wird durch Kegelräder eine stehende Welle J, welche am unteren Ende Schaufeln trägt, angetrieben.
Die letzteren bewegen sich in einem geschlossenen und mit Wasser gefüllten Gehäuse,
auf dessen Boden Rippen angebracht sind. Das Gehäuse ist ebenfalls drehbar, wird
aber verhindert, an der Rotation theilzunehmen, indem ein an demselben befestigter
Arm L sich gegen den auf der stehenden Welle O befestigten und mit der Feder K verbundenen Arm M (in Fig. 11
punktirt) legt. Je nach der Geschwindigkeit der Welle J
bezieh. der Welle A wird indessen durch den
hydraulischen Widerstand im Gehäuse der Widerstand der Feder K mehr oder weniger überwunden und dem Gehäuse eine geringe Drehung
ertheilt werden, welche durch die Arme L und M auch auf die Welle O
übertragen wird. Von dieser wird durch den Arm V dem
Schreibstift
S, welcher ebenfalls die Trommel T berührt, eine entsprechende Verschiebung ertheilt.
Die Form der Arme L und M
ist (gleichfalls durch Versuche) so bestimmt, daſs der Ausschlag des Schreibstiftes
proportional der Geschwindigkeit der Welle A wird,
welche noch durch einen Tourenzähler controlirt werden kann. Man erhält auf diese
Weise auf demselben Blatt zugleich eine Curve der Umfangskraft und eine Curve der
Geschwindigkeit. – Um das Product aus beiden in jedem Augenblick ablesen zu können,
ist auf der Welle O noch ein Arm W mit Schreibstift angebracht, welcher sich über einer
Tafel N bewegt. Diese ist mit der in A steckenden Spindel verbunden und nimmt, auf
horizontalen Schienen geführt, an der Verschiebung derselben theil. Für die relative
Bewegung des an W befindlichen Schreibstiftes gegen die
Tafel N ist also sowohl die Umfangskraft, wie die
Geschwindigkeit bestimmend. Man kann nun auf der Tafel Curven gleicher Arbeitsgröſse
verzeichnen und dann aus der Lage des Schreibstiftes den betreffenden Werth
jederzeit erkennen.
In Fig. 14 sind die beiden auf die Trommel T
aufgezeichneten Curven dargestellt, welche sich beim Betriebe eines Selfactor
ergeben haben. Beide haben ihre Nulllinien auf entgegengesetzten Seiten, so daſs man
sich die obere Curve, d. i. die der Geschwindigkeiten, umgekehrt zu denken hat, wenn
die Nulllinien zusammenfallen und die Ordinaten gleiche Richtung haben sollen.
Dasselbe gilt von den Curven Fig. 15,
welche einer Watermaschine entnommen sind; auſserdem erscheint hier die eine Curve
gegen die andere um das Stück ab verschoben, so daſs
der Punkt m der Geschwindigkeitscurve dem Punkte n der Spannungscurve entspricht.
Whg.
Tafeln