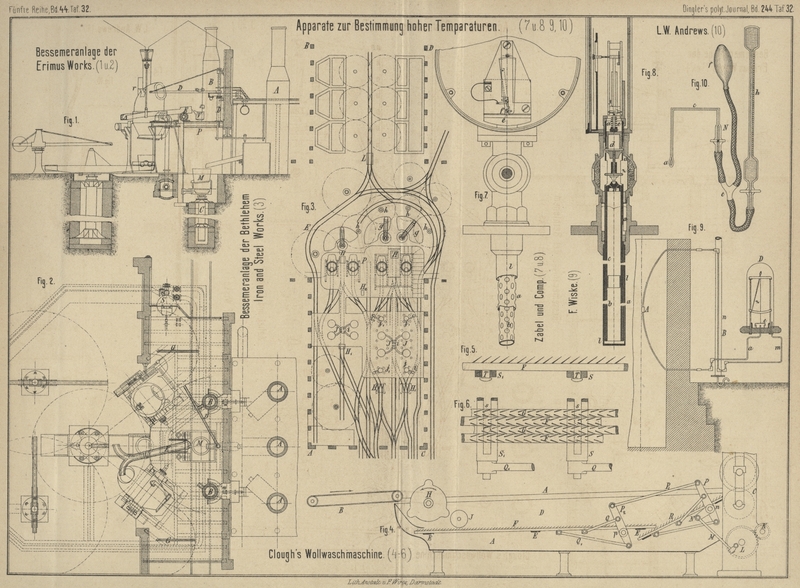| Titel: | Neue Bessemerwerke. |
| Autor: | St. |
| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 433 |
| Download: | XML |
Neue Bessemerwerke.
Mit Abbildungen auf Tafel 32.
Neue Bessemerwerke.
Eine der groſsartigsten Bessemeranlagen der Neuzeit besitzt die Bethlehem Iron Company in Pennsylvanien. Bei keiner
anderen Anlage werden die Vortheile des maschinellen Transportes der Roh-, Zwischen-
und Fertigproducte so ausgenutzt wie gerade hier und ist besonders letzteres der
Grund, weshalb die Leistung der amerikanischen Bessemerwerke bis jetzt noch
unerreicht dasteht.
Das betreffende Gebäude ABCD (Fig. 3 Taf.
32) ist 284m lang und 30m tief. In dem Seitenflügel E sind die Gebläsemaschinen und Pumpen untergebracht. Die Zapfen
der 4 Birnen sind etwa 3m,8 über der Hüttensohle
gelagert, In fast derselben Höhe ruht auf Säulen die Bühne P, auf welcher die groſsen Cupolöfen J und
die Spiegelöfen j1
stehen. Auf der Hüttensohle liegen zwischen den Säulen Schienengeleise für 2
Locomotiven, welche die Zufuhr von Rohstoff, bezieh. die Abfuhr der Zwischen- und
Fertigproducte des ganzen Betriebes bewältigen. In den Geleisen sind hydraulische
Aufzüge H1 und H eingeschaltet, von denen erstere zur Gichtbühne der
Cupolöfen führen, H dagegen das in die bei i oder i1 auf Transportwagen stehenden Gieſspfannen
abgestochene Roheisen bis zum Birnenmund heben, um dasselbe in diese zu entleeren.
Der Aufzug H2 dient zum
Heben von Zuschlagsmassen für die Birnen. Von den beiden links liegenden Birnen
besitzt jede eine sectorähnliche Gieſsgrube g mit je
einem Gieſskrahn und je 2 Blockkrahnen h. Die beiden
rechts liegenden Birnen haben zusammen eine Gieſsgrube mit einem Gieſskrahn und 2
Blockkrahnen. Auſserdem sind noch 3 Nebenkrahnen vorhanden. Die Hauptgeleise
vereinigen sich bei L auf einer Wage, von wo die noch
roth glühenden Blöcke in die Wärmöfen des Walzwerkes gelangen.
Wie ersichtlich, ist bei der ganzen Anlage die gröſst mögliche Freiheit der
Bewegungen nach allen Seiten gewahrt, so daſs eine Anhäufung von Schlacke oder
Guſsblöcken in Folge mangelnder Transportmittel behufs Wegschaffung derselben gar
nicht vorkommen kann. Eine Belästigung der Arbeiter durch allzu groſse Hitze ist
hierdurch ebenfalls ausgeschlossen. Ein Entleeren der Cupolöfen behufs Ausbesserung
durch herunterklappbare Böden ist ebenfalls ermöglicht. Es sei endlich noch auf die
kurzen festen Guſsrinnen i der Cupolöfen hingewiesen,
welche einer Zusammenfügung und Nachhilfe nach jedem Guſs nicht bedürftig sind.
Auch in den maschinellen Einzelheiten weist die amerikanische Anlage wesentliche
Verbesserungen gegen die europäischen Werke auf. So ist z.B. das obere Plungerende
des Gieſskrahnes in dem Deckengebälk geführt, so daſs man zur Drehung des Krahnes
nur verhältniſsmäſsig wenig Arbeiter bedarf. Die Gieſspfanne ist mit den Trägern des
Gieſskrahnes wie gewöhnlich durch Schneckengetriebe drehbar verbunden, sie läſst
sich aber nicht auf den Trägern verschieben. Um trotzdem die Pfanne in radialer
Richtung verstellen zu können, sind beide durch einen Querbalken mit einander
verbundenen Träger durch je 3 Rollen, von denen zwei direct am Plunger, eine aber an
einem am Plunger befestigten Arm angeordnet sind, geführt und mittels eines doppelt
wirkenden hydraulischen Cylinders, in welchem ein an dem Querbalken befestigter
Kolben spielt, mit dem Plunger verbunden. Der Cylinder wird durch den hohlen
Plungerkolben hindurch mit Wasser gespeist. Die Katzen der Blockkrahnen, welche
gewöhnlich lose auf den
Trägern laufen, sind ebenfalls durch doppelt wirkende hydraulische Cylinder und
Kolben, welche zwischen den Trägern gelagert sind, mit den Plungern verbunden, so
daſs die Bewegung der Guſsblöcke beliebig geregelt werden kann. Der am Cylinder
befestigte Steuerhahn wird durch Kettenrad mit Kette von unten durch Hand bewegt.
All diese Einrichtungen bezwecken eine Schonung der menschlichen Arbeitskräfte beim
Transport der Guſsblöcke, um dieselben mit um so gröſserem Vortheil während des
Gusses, wo die gröſste Aufmerksamkeit und Umsicht nothwendig ist, verwerthen zu
können.
Der hohle Zapfen, welcher den Gebläsewind dem Birnenboden zuführt, ist nicht
geschlitzt, sondern an seinem Stirnende offen, so daſs der Wind aus dem hohlen
Ständer durch jenes Stirnende in den Zapfen eintritt. Dabei ist das Stirnende des
Zapfenlagers durch eine abnehmbare Platte geschlossen, so daſs die kleine, am Zapfen
befestigte Stopfbüchse, welche die Dichtung zwischen diesem und der Lagerschale
bewirkt, leicht zugänglich gemacht ist, ohne die Stellung der Birne im geringsten zu
beeinflussen. Das Einsetzen der Böden wird mittels fahrbarer hydraulischer
Hebevorrichtungen bewerkstelligt, welche unter die Birne gefahren und sodann mit der
Druckwasserleitung durch einen Schlauch verbunden werden. Eine Entlastung der
Radachsen ist dabei in der Weise vorgesehen, daſs zwischen den Cylinder und das
Geleise besondere Unterlagsklötze geschoben werden.
Interessant ist die Vorwärmung der verschiedenen Gieſspfannen mit Gasfeuerung. In
Deutschland benutzt man dazu gewöhnlich glühende Guſsblöcke oder brennende Kokes.
Dies auch in vorliegendem Falle zu thun, ist wegen der groſsen Zahl der beständig in
Gebrauch stehenden Gieſspfannen und wegen der groſsen Wärmemenge, welche
erforderlich ist, um dieselben in kürzester Zeit in helle Rothglut zu versetzen,
unzulässig, wenn man sich nicht der Gefahr aussetzen will, kalte Gänge zu erhalten.
Auf den genannten Werken ist deshalb ein besonderer Vorwärmeraum angeordnet, der für
20 Gieſspfannen Platz hat und durch welchen ein Gasrohr eines Siemens'schen
Generators geleitet ist. Von diesem Rohr gehen seitliche Abzweigungen mit senkrecht
nach unten gerichteten Stutzen ab, an deren unteren Enden starke guſsstählerne
Deckel, durch Ketten und Gegengewichte verschiebbar, aufgehängt sind. In der Mitte
des senkrechten Gasstutzens mündet ein dünnes Rohr, welches mit der Windleitung in
Verbindung steht. Soll eine Pfanne angewärmt werden, so wird dieselbe durch eine
Locomotive unter den Deckel gefahren, letzterer gesenkt, mit dem oberen Pfannenrande
verschmiert und das Gas- und Luftventil geöffnet. Nach Anzündung der Gase, welche
seitlich durch eine Deckelöffnung entweichen, kann die Pfanne schnell bis zur hellen
Rothglut gebracht werden.
Das Birnenfutter besteht aus natürlichen Steinen aus Glimmerschiefer. Mit einem solchen Futter werden
20000 bis 30000t Stahl erblasen. Die Böden haben
17 Düsen mit je 12 Windlöchern; die Räume zwischen den Düsen werden mit Steinen
ausgemauert und bedürfen der schmalen Fugen wegen einer nur 6stündigen Trocknung.
(Nach Engineering, 1881 Bd. 32 S. 427.)
Die allgemeine Anordnung der Bessemeranlage der Erimus
Works in Middlesbrough gewinnt durch den Umstand besonderes Interesse, als
die Anlage anfänglich für den Danks'schen Puddelproceſs gebaut und erst später dem
basischen Bessemerproceſs angepaſst wurde. Im Uebrigen zeigt auch diese in Fig.
1 und 2 Taf. 32
skizzirte Anlage sehr bemerkenswerthe Constructionen. Die Cupolöfen A zum Umschmelzen des Roheisens stehen auſserhalb der
eigentlichen Bessemerhütte auf der Hüttensohle und entleeren das niedergeschmolzene
Roheisen in eine Pfanne M, welche durch einen
hydraulischen Aufzug C bis in die Höhe der Guſsrinne
E gehoben werden kann. Der Plunger des Aufzuges hat
einen Durchmesser von 0m,355 und einen Hub von
6m,247. Die Begrenzung des Hubes geschieht
nach unten und oben selbstthätig durch den Abstellschieber bewegende Anschläge. Die
Pfanne M faſst 6t
Eisen mit der entsprechenden Menge Schlacke und wird nicht in die Rinne E gekippt, sondern abgestochen. Die Rinne E ist vorn an dem Gebälk des Gebäudes aufgehängt und
läuft an ihrem hinteren Ende auf Rädern. Die über der Ebene der Birnenachsen
liegenden Spiegeleisenöfen B haben 1m,320 inneren Durchmesser und liegen seitwärts des
Aufzuges M. Das Spiegeleisen wird in kleine Pfannen V abgestochen, welche durch den kleinen hydraulischen
Wandkrahn D gehoben und in die Rinne E gekippt werden. Während des Abstiches wird die
Spiegeleisenmenge durch einen in die Aufhängevorrichtung der Pfanne eingeschalteten
Wägeapparat gewogen.
Der Krahn wird von der Bühne P aus gehandhabt. Die
beiden Birnen haben 2m,438 äuſseren Durchmesser
und 25mm starke schmiedeiserne Mäntel. Von der
Drehachse aus beträgt die gröſste Höhe nach oben 2m,641, nach unten bis zum Windkasten 1m,774. In der Haubenrundung besitzt die Birne einen rinnenförmigen Ansatz r, durch welchen das Eisen in gekippter Lage der Birne
abgestochen werden kann, wenn bei der Ausführung des basischen Verfahrens der
Birnenmund sich verstopfen sollte. Die Birnenachse liegt 4m,723 über der Hüttensohle. Die Kippvorrichtung
besteht aus einem beweglichen horizontalen Cylinder, dessen obere Seite mit Zähnen
versehen ist, welche in das auf der Birnenachse aufgekeilte Getriebe greifen. Der
Kolben, über den sich der Cylinder hin und her schiebt, besitzt behufs Durchleitung
des Druckwassers eine hohle Kolbenstange, welche mit den Ständern fest verbunden
ist.
G bedeuten kleine Handkrahnen zum Heben von
Windkastendeckeln u.s.w. Der Gieſskrahn hat einen Plunger von 0m,609 Durchmesser und 10m,973 Länge. Der Hub beträgt 5m,791. Der von der Gieſspfanne zu bestreichende
Kreis hat 5m,181 im Halbmesser. Der groſse Hub und
die auſserordentliche Länge des Gieſskrahnes ist nothwendig, um das in der einen
sauren Birne entsilicirte Roheisen in die Gieſspfanne zu kippen und diese dann über
die Mündung der gekippten basischen Birne zu heben und in diese durch das
Bodenventil zu entleeren. Die beiden Blockkrahnen haben 254mm bezieh. 406mm
Plungerdurchmesser und 5m,486 Ausladung mit einem
Hub von 2m,285. Ihr todtes Gewicht ist gröſser wie
die zu hebende Last. Um die Fundamentgruben der Erahne wegen des hohen
Grundwasserstandes leicht entwässern zu können, sind die Gruben oben luftdicht
abgeschlossen und durch die Decke 2 Rohre geführt, von denen eines bis auf den
Boden, das andere nur bis unter die Decke reicht. Verbindet man letzteres mit der
Windleitung, so kann das Wasser aus der Grube durch Luftdruck entfernt werden. Der
Accumulator hat einen Plungerdurchmesser von 0m,609, einen Hub von 6m,095 und übt einen
Druck von 40at aus. Zum Einführen von Kalkpulver
in die Birne mit dem Gebläsewind ist in die Windleitung ein 3m,047 hoher und 1m,524 im Durchmesser habender senkrechter Cylinder S eingeschaltet, welcher oben mit einem hermetisch schlieſsenden Deckel
versehen ist und unten, anschlieſsend an den schrägen Boden eine Transportschnecke
trägt, die durch Maschinenkraft bewegt wird. Da durch ein Zweigrohr der obere Theil
des Cylinders mit gepreſster Luft gefüllt ist, so fällt Kalkpulver in durch die
Umdrehungszahl der Transportschnecke geregelten Mengen in die Windleitung und wird
von dem Wind dem Eisenbad in der Birne zugeführt.
Die Flamme der Birnen durchstreift einen Röhren-Winderhitzungsapparat, welcher den
Cupolofenwind auf 232° erhitzt. Es soll dadurch eine Kokesersparniſs von 25 Proc.
erreicht worden sein. (Nach dem Engineering, 1881 Bd. 32 S.
482.)
St.
Tafeln