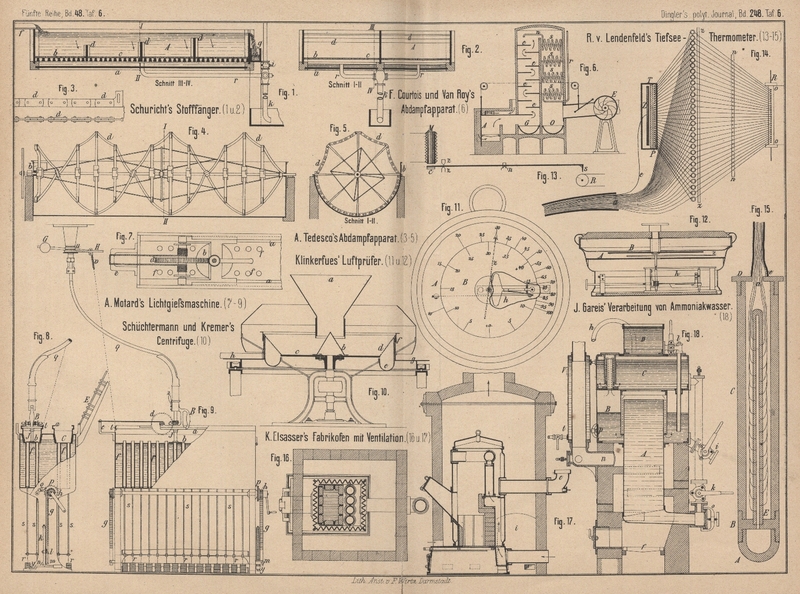| Titel: | Lichtgiessmaschine von A. Motard und Comp. in Berlin. |
| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 69 |
| Download: | XML |
Lichtgieſsmaschine von A. Motard und Comp. in
Berlin.
Mit Abbildungen auf Tafel 6.
Motard's Lichtgieſsmaschine.
A. Motard und Comp. in Berlin (*D. R. P. Kl. 23 Nr.
17325 vom 6. September 1881) vereinigt Lichtgieſsmaschine und Schneidmaschine, um das Zerbrechen und die
Verunreinigung der Kerzen auf der bisherigen Schneidmaschine zu verhüten.
Auf dem oberen Rand der Maschine ist eine Schlittenführung a (Fig. 7 bis
9 Taf. 6) so befestigt, daſs die Schneidmaschine B leicht eingesetzt und ausgehoben werden kann. Die senkrechte Welle J trägt unten die Kreissäge b, weiter oben die Schraube ohne Ende c,
welche in das Rad d eingreift, auf dessen Achse sich
eine über den Bügel e gespannte Schnur aufwickelt, so
daſs die Säge selbstthätig von einem Ende der Maschine zum anderen bewegt wird.
Zur Füllung der Formen f wird das betreffende Material
in das Gieſsschiff C eingegossen. Von der durch Trieb
h bewegten Zahnstange g wird ein Rahmen getragen, auf welchem sich, der Anzahl der Guſsformen
entsprechend, lange Röhrchen s befinden, so daſs durch
Anheben dieser Röhren die erkalteten Lichte nach oben bewegt und die durch s laufenden Dochte r
nachgezogen werden. Mit der Windevorrichtung hängt ein Tritthebel n zusammen, an dessen senkrechtem, geschlitztem Theile
k die Nase l so
einstellbar ist, daſs die Lichte in bestimmter Länge und bestimmtem Gewicht
geschnitten werden können, indem beim Aufwinden der Steg m gegen die Nase l anschlägt. Auſserdem ist
an einer Seite eine ihrer Länge nach verstellbare Sperrklinke o angebracht, welche so eingestellt wird, daſs sie für
den ersten Anhub genau in das Sperrrad p einfällt und
den Rückgang hindert.
Nachdem dies geschehen, wird von der aus Drahtspiralen gebildeten biegsamen Welle q mittels Verkuppelung bei z die Bewegung auf die Kreissäge übertragen, so daſs diese, sich
selbstthätig vorwärts bewegend, die über den Rand der Formen ragenden
Ueberguſsstücke abschneidet. Hierauf wird durch den Arbeiter der Tritt y abwärts bewegt, dadurch die Nase l zurückgezogen, wonach ein weiteres Aufwinden der
Lichte aus den Formen stattfindet. Dabei bewegen sich die Lichte, durch welche
gleichzeitig die Dochte r nachgezogen sind, durch die
niedergeklappte Klemmvorrichtung E und werden dort so
lange festgehalten, bis die Röhren s mit ihrem
trichterförmigen Aufsatz niedergewunden sind und ein erneutes Füllen der Formen
stattgefunden hat.
Die Säge, welche bereits vorher am Ende ihrer Bahn anlangte, wird dadurch
selbstthätig ausgerückt, daſs die vordere Supportkante an den an einer Kette
befestigten Ring t stöſst, wonach das Gewicht G derart zur Wirkung gelangt, daſs mittels des
Riemenführers H der Riemen auf die lose Scheibe u gebracht wird. Die Feder v dient zur Ausgleichung etwaiger Unterschiede in der Entfernung von der
Transmission zu den einzelnen Maschinen.
Tafeln