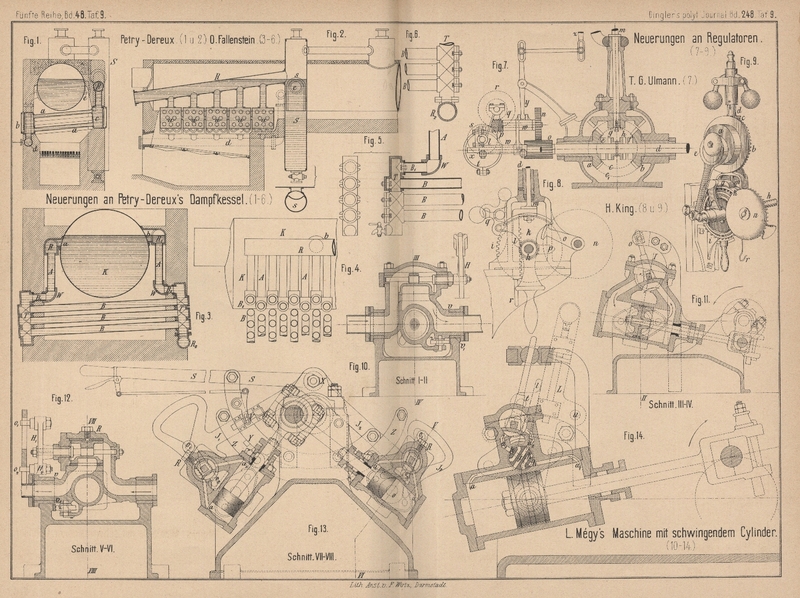| Titel: | Neuerungen am Petry-Dereux'schen Dampfkessel. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 149 |
| Download: | XML |
Neuerungen am Petry-Dereux'schen
Dampfkessel.
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 9.
Neuerungen am Petry-Dereux'schen Dampfkessel.
Die beiden in Fig. 1 bis
6 Taf. 9 dargestellten Anordnungen von Dampfkesseln, welche als
Abänderungen des unter Nr. 14554 patentirten Kessels von Petry-Dereux (vgl. 1882 243 * 93) angesehen
werden können, sind wie die Nicol'schen (1882 243 * 92) und andere verwandte Constructionen
hauptsächlich zur Vergröſserung der Heizfläche vorhandener gewöhnlicher Walzenkessel
geeignet.
Die Fig. 8 bis 6 Taf. 9
zeigen eine Anordnung von O. Fallenstein in Düren bei
Köln (*D. R. P. Nr. 17833 vom 3. Juli 1881, abhängig von Nr. 10876 und Nr. 14554).
Die etwas geneigten, zu je 3 und 4 über einander liegenden Querröhren B sind an beiden Enden in kurze vertikale Gruſsrohre
T eingesetzt, welche durch Rohrstücke B1, W und A mit zwei neben dem
Kessel K angebrachten guſseisernen Rohren R und R1, verbunden sind. R
steht durch einen Stutzen a nur mit dem Wasserraume,
R1 durch einen
Stutzen b mit dem Dampfraume des Kessels in Verbindung,
so daſs ein lebhafter Wasserumlauf durch die Röhren B
hindurch stattlinden wird. Die Rohre R und R1 haben ebene Böden,
in welche die hängenden Röhren A eingeschraubt sind.
Mit den kurzen Stutzen B1 sind die Guſsrohre T durch Flanschen
verbunden, um die Röhren B bequem auswechseln zu
können. Behufs Reinigung derselben sind die Rohre T
auſsen, den Röhren B gegenüber, mit Oeffnungen
versehen, welche mit flachen Deckeln mittels je zweier Einsteckschrauben
verschlossen werden. Die Höhren B werden in die Rohre
T auf die gewöhnliche Weise mit Hilfe der Siederohr-Dichtmaschine
eingepreſst. An jedem der Rohre T, welche die tiefer
liegenden Enden der Röhren B verbinden, ist ein
Ausblashahn angeordnet (vgl. Fig. 5),
während die Rohre T der anderen Seite unten mittels
Flanschen mit einem gemeinschaftlichen Schlammsammelrohre R2 verbunden sind.
Die in Fig. 1 und 2 Taf. 9
dargestellte neuere Construction von Petry-Dereux in
Düren bei Köln (*D. R. P. Nr. 18796 vom 21. Mai 1881) scheint aus dem Bestreben, ein
unabhängiges Patent zu erhalten, hervorgegangen zu sein. In anderer Weise läſst es
sich wohl kaum erklären, daſs bei dieser neueren Anordnung auf den so werthvollen
Wasserumlauf verzichtet ist. Die Röhrenbündel a sind
auch hier wie bei der früheren Anordnung (1882 243 * 93)
beiderseits in parallelepipedische Kasten b und c eingedichtet. Die tiefer liegenden Kasten b der einen Seite sind mit einem horizontal unter ihnen
liegenden Rohre d verbunden und die höher liegenden
Kasten c mit einem über denselben befindlichen, stark
geneigten Rohre R, welches im höchsten Punkte in einem
vertikal angeordneten Schlammsammler S mündet. Das
Speisewasser wird in das Rohr d eingeführt. Es soll nun
eine Verbindung des Röhren- und Kammersystemes mit dem Wasserraume des Dampfkessels
entweder durch eine Fortsetzung des Rohres d nach oben, oder durch
einen vom Schlammsammler S ausgehenden Stutzen e hergestellt werden. Im ersten Falle flieſst je nach
dem Verhältnisse der Heizfläche des Kessels zu der der Röhren ein kleinerer oder
gröſserer Theil des Speisewassers direkt in den Kessel:, der in der Regel wohl
gröſsere Theil steigt in den Röhren auf und gelangt aus dem höchsten Theile des
Schlammsammlers erst als Dampf in den Kessel. Dabei ist allerdings nicht
ausgeschlossen, daſs wegen der starken Verdampfung in den Röhren bedeutende
Wassermassen mit in den Kessel hinübergerissen werden. Der obere Theil des Rohres
R und des Schlammsammlers S wird mit einem Gemische von Wasser und Dampf gefüllt und ein bestimmter
Wasserstand in denselben kaum vorhanden sein, jedenfalls müſste derselbe viel höher
als im Kessel liegen. Im zweiten Falle, wenn der Schlammsammler mit dem Kessel durch
einen Stutzen e verbunden ist, gelangt alles
Speisewasser zunächst in die Röhren und dann, soweit es in diesen nicht verdampft,
durch e in den Kessel. Auch in diesem Falle wird, da
für die Trennung des in den Röhren entwickelten Dampfes von dem Wasser in S nur eine sehr kleine freie Oberfläche vorhanden ist,
an dieser Stelle eine sehr ungestüme Bewegung vorhanden und R und S oben mit Schaum gefüllt sein.
Jedenfalls steht diese Anordnung hinter denen mit ununterbrochenem, lebhaftem
Wasserumlaufe zurück.
Vor dem Stutzen e ist in S
eine oben geschlossene Mulde s befestigt, so daſs das
aus den Röhren kommende Wasser in S zunächst abwärts
strömen muſs, um, von unten in die Mulde s eintretend,
nach e
an gelangen. Es soll
hierdurch die Sehlammablagerung in S befördert
werden.
Whg.
Tafeln