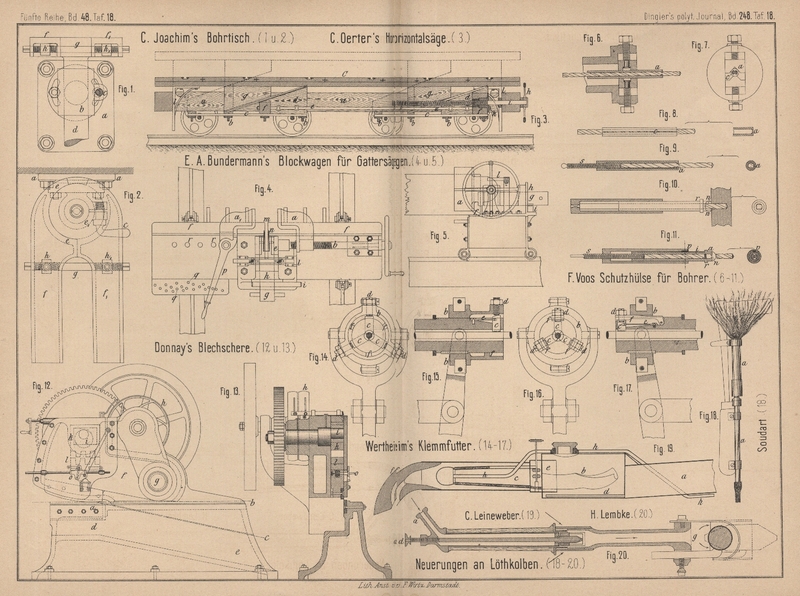| Titel: | Neuerungen an Löthkolben. |
| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 272 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Löthkolben.
Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 18.
Neuerungen an Löthkolben.
Bei dem Erdöl-Löthkolben von C.
Leineweber in Viersen (* D. R. P. Nr. 20615 vom 18. April 1882) wird der Kolben f (Fig. 19
Taf. 18) durch die Flamme eines gewöhnlichen Erdölbrenners c erhitzt, welche mit Luft aus dem Rohre h
durch ein Gebläse angefacht wird. Der eigentliche Erdölbehälter a steht mit der Dochtbüchse b durch das Zuführungsrohr d
in Verbindung, so daſs
in den Behälter b nur so viel Oel zuflieſsen kann, als
die Flamme benöthigt. Das in b befindliche Oel sammelt
sich hinter dem Rande e, wenn derselbe umgekehrt wird.
Die durch das Gebläse erzeugte Stichflamme soll den Kolben binnen 2 Minuten
brauchbar erhitzen. Der Kolben f ist keilförmig
zugehauen und wird auf das Brennerrohr geschraubt.
Nach dem Metallarbeiter, 1882 S. 310 wird von H. Lembke in Berlin der in Fig. 20
Taf. 18 dargestellte Gaslöthkolben ausgeführt. Derselbe
soll eine sehr einfache Regulirungsweise des Gas- und Luftzutrittskanales und die
Möglichkeit gewähren, den Apparat an jeden Gashahn zu verwenden. Zur Erhitzung des
Kolbens wird derselbe am Stutzen a durch einen Schlauch
mit der Gasleitung in Verbindung gebracht und dann das Gas bei der
Ausströmungsöffnung g angezündet. Die Regulirung
erfolgt durch Stellen der Schraubenspindel d, durch
welche die Menge des entweichenden Gases bestimmt wird. Soll weniger Gas ausströmen,
also die Spindel d etwas mehr zugeschraubt werden, so
muſs man vorher die Luftregulirungshülse entsprechend stellen, damit nicht zu viel
Luft eintritt und dadurch ein Zurückschlagen der Flamme verursacht wird. Diese
einfache Regulirbarkeit ermöglicht die für manche Fälle sehr wünschenswerthe
Verwendung von Löthkolben verschiedener Gröſse, da man durch zweckmäſsiges
Schlieſsen der Spindel d verhindern kann, daſs die
Kolben zu sehr erhitzt und verbrannt werden, und man andererseits durch volles
Oeffnen der Regulirvorrichtung im Stande ist, schwere Löthkolben rasch zu erhitzen.
Ein solcher Löthkolben von 0k,5 Gewicht soll in 4
Minuten vollständig heiſs werden und es können auch Kolben von 0k,75 noch mit Vortheil verwendet werden.
Von Soudart ist ein Gaslöthapparat angegeben, bei welchem die Zuführung von Gas und Luft, wie
Fig. 18 Taf. 18 zeigt, seitlich durch ein eigenes Rohr a erfolgt. Diese Anordnung bezweckt, der Verbindung der
Theile, welche bei der Zuleitung durch den Stiel des Löthkolbens selbst in Folge der
Uebertragung der Hitze nach und nach eine lockere werden kann, gröſsere Festigkeit
zu geben, und sie bietet auſserdem den Vortheil, daſs sie sich leicht an jedem
Hammerkolben anbringen läſst. (Vgl. die Uebersicht 1882 246 * 403.)
Tafeln