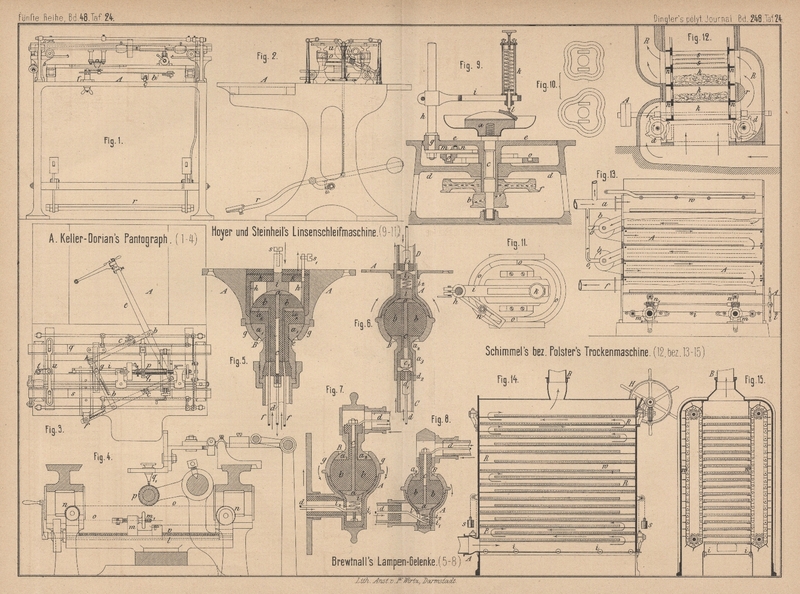| Titel: | A. Brewtnall's Kugelgelenke für elektrische Lampen. |
| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 363 |
| Download: | XML |
A. Brewtnall's Kugelgelenke für elektrische
Lampen.
Mit Abbildungen auf Tafel 24.
Brewtnall's Kugelgelenke für elektrische Lampen.
A. Brewtnall in Streatham hat die nach Engineer, 1883 Bd. 55 S. 205 in Fig. 5 bis
8 Taf. 24 abgebildeten Kugelgelenke entworfen, um mittels derselben an
elektrischen Lampen und anderen elektrischen Leitungen den elektrischen Stromkreis
ununterbrochen zu erhalten, wenn die Träger u.s.w. gedreht werden müssen. Fig.
5 und 6 zeigen die
Anordnung für Hängelampen, und zwar Fig. 5 bei
Anwendung einer besonderen Rückleitung, Fig. 6 bei
Benutzung der äuſseren Metalltheile als Rückleiter. Fig. 7 und
8 geben die Anwendung der in Fig. 6
dargestellten Einrichtung für die ersten und späteren Gelenke an Wandarmen. In allen
Figuren bezeichnet B die Kugel und A ihren Sitz. In Fig. 5
besteht die Kugel aus 3 Theilen a bis a2 mit isolirenden
Zwischenlagen b; steht durch den Stiel c mit der Hinleitung d zur
Lampe in Verbindung; die Rückleitung f von der Lampe
schlieſst sich an a2
und an das Futter h an, während a sich in der Höhlung des Zapfens i drehen
kann. An die Schrauben s und s1 kommen die Zuleitungen; a2 mit dem angelötheten
Rohre e ruht auf der Schale g des Trägers. In Fig. 6 geht
die Hinleitung d
von dem Zapfen d1 in dem Isolirmittel
d2 aus, welches in
das conische Ende des Rohres C eingelassen ist; wird
C in a3 eingeschraubt, so berühren sich die
Schraubenmutter c1 und
der Kopf des Bolzens an c. Der Zapfen, gegen welchen
sich a legt, besteht aus 2 Theilen i und i1 die durch eine Metallspirale i2 verbunden sind,
welche in ihrer Wirkung der Gummischeibe k in Fig.
5 gleich kommt; beim Aufschrauben des Rohres D wird i3
gegen i1 gepreſst. Fig.
7 und 8 sind ohne
weiteres verständlich, da die betreffenden Theile mit denselben Buchstaben
bezeichnet sind wie in Fig. 6.
Tafeln