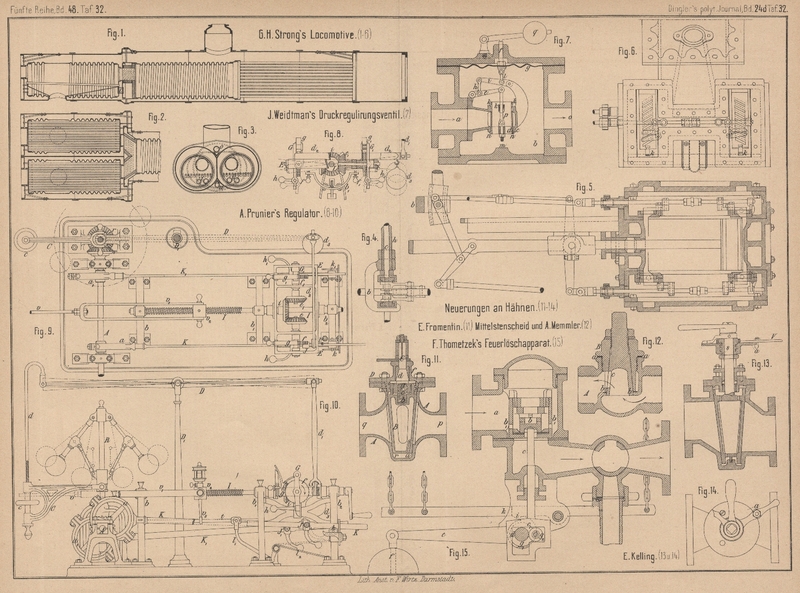| Titel: | Druckregulirventil von J. Weidtman in Dortmund. |
| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 479 |
| Download: | XML |
Druckregulirventil von J. Weidtman in
Dortmund.
Mit Abbildung auf Tafel 32.
J. Weidtman's Druckregulirungsventil.
Das vorliegende, in Fig. 7 Taf.
32 abgebildete Druckregulirventil (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 21751 Vom 17. August 1882)
gehört zu den ApparatenEine kritische Uebersicht über Druckregler
(Gasregulatoren, Dampfreducirventile u. dgl.) von Herm. Fischer brachte kürzlich die Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 * S. 241 und
315., bei welchen die Einstellung des den Durchgang der
Flüssigkeit regelnden Organes (hier ein Ringkolben) durch den hinter demselben
herrschenden Druck selbstthätig geschieht, Dieser Druck wird durch eine federnde
gewellte Platte g aufgenommen, deren Durchbiegungen
durch den skizzirten Hebelmechanismus sehr stark vergröſsert auf den Kolben
übertragen werden. Dementsprechend braucht die Durchbiegung der Plattenfeder nur
gering zu sein, so daſs man ihre Federkraft ganz vernachlässigen kann. Dann bedarf
es aber, um den Druck in der Zuleitung unveränderlich auf gleicher Höhe zu erhalten,
nur einer Anordnung, welche jede Einwirkung des in der Zuleitung herrschenden
Druckes auf den Kolben unmöglich macht. Zu diesem Behufe umgibt das die Fortsetzung
des Zuleitungsrohres bildende Gehäuse c den Kolben d von allen Seiten, so daſs sich die vom Drucke der
zuflieſsenden Flüssigkeit auf ihn entfallenden Pressungen gegenseitig vollkommen
aufheben.
Der Kolben d ist mittels der Stange p an den einarmigen Hebel e angehängt, an dessen kürzeren Hebelarm die Stange h angelenkt ist, welche wieder am Ende des Hebels i angreift, dessen kürzerer Arm durch das Lenkstück l mit der Stange f in
Verbindung steht, f ist luftdicht in der Plattenfeder
g befestigt und tritt durch den Deckel des die
ganze Vorrichtung einschlieſsenden Gehäuses nach auſsen, wo sie durch den
Gewichtshebel q belastet ist. Im ruhenden Zustande
drückt q die Stange f und
damit auch den Kolben d nieder, bis letzterer auf dem
Vorsprunge m des Bodens aufsteht. In dieser Lage kann
die durch a hergeleitete, das Gehäuse c füllende Flüssigkeit durch die im Kolben ausgesparten
Oeffnungen k in den Raum b
und von hier aus in die bei o anschlieſsende
Ableitungsrohre treten. Ist dann hier die gewünschte Spannung erreicht, so erlangt
der Druck auf die Plattenfeder g das Uebergewicht über
die auf f ruhende Gewichtsbelastung; die Plattenfeder
g und mit ihr das Ventil werden gehoben. Dadurch
ist aber der Durchgang der Flüssigkeit durch die Oeffnungen k aufgehoben, bis die Spannung in b sich
wieder so weit vermindert hat, daſs g und damit auch
d so tief sinken, um eine neue Flüssigkeitsmenge
durch die Oeffnungen k eintreten zu lassen. Durch
Veränderung der Belastung der Stange f kann man die
Spannung in b und der Ableitung beliebig reguliren. Ein
Vorsprung n am Kolben d
verhindert eine zu groſse Erhebung desselben, wenn die Ableitung o etwa abgestellt sein und durch kleine Undichtheiten der bei a herrschende Druck sich nach b fortpflanzen sollte.
Tafeln