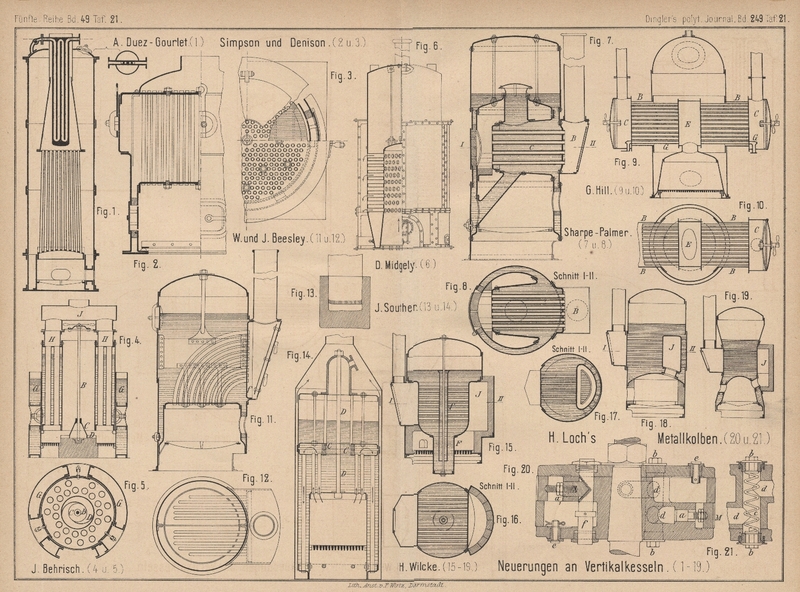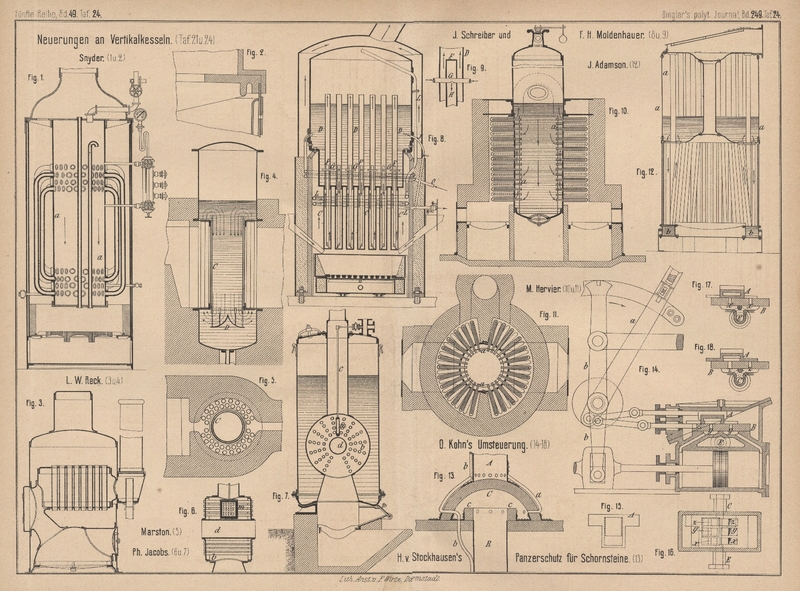| Titel: | Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln. |
| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 321 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 21 und 24.
Neuerungen an Vertikalkesseln.
Die stark zunehmende Verwendung der Dampfmaschinen im Kleinbetriebe macht es
erklärlich, daſs in jüngster Zeit zahlreiche neue Constructionen der für den Kleinbetrieb sehr geeigneten stehenden Kessel
auftauchen. Es sind diesmal nur Röhrenkessel zu verzeichnen, sowohl solche mit
Rauch- oder Heizröhren, durch welche die Heizgase ziehen, wie auch solche mit
Wasserrohren, in welchen hauptsächlich die Dampfbildung vor sich geht.
1) Heizröhrenkessel.
In Fig.
1 bis 5 Taf. 21
sind zunächst 3 Kessel dargestellt, bei welchen, wie bei manchen anderen bekannten
Constructionen, eine unten im Kessel liegende Feuerbüchse mit einer oben liegenden
Rauchkammer durch ein Röhrenbündel verbunden ist.
An dem Kessel Fig. 1 von
A. Duez-Gourlet in Jemappes, Belgien, (Erl. * D. R.
P. Nr. 11504 vom 23. März 1880) ist bemerkenswerth, daſs in die verhältniſsmäſsig
lange, trichterförmige Rauchkammer ein Dampftrockner bezieh. Ueberhitzer eingehängt
ist, der bei stehenden Kesseln wegen der geringen- Wasseroberfläche sehr angebracht
erscheint. Die dargestellte Form – ein flaches Guſsstück, in welches ein
schlangenförmig gewundener Kanal eingegossen ist und das allerdings beim Anheizen
u.s.w. nicht leicht verbrennen kann –, dürfte doch wohl kaum brauchbar sein, da eine
gründliche Reinigung desselben ausgeschlossen ist.
Fig.
2 und 3 Taf. 21
zeigen nach Engineering, 1882 Bd. 34 S. 83 einen als
Schiffskessel benutzten Dampferzeuger von Simpson und
Denison in Dartmouth, welcher sich durch seinen auſsergewohnlich groſsen
Durchmesser und besonders noch dadurch auszeichnet, daſs der obere Theil erweitert
ist, um eine möglichst groſse freie Wasseroberfläche zu erhalten. Die Feuerbüchse
ist sehr weit und hoch, damit auch mit Holz gefeuert
werden kann.
Bei der Construction Fig. 4 und
5 Taf. 21, welche von J. Behrisch in Colin
a. d. Elbe (Erl. * D. R. P. Nr. 17167 vom 7. Juli 1881) herrührt, ist der Kessel zur
Aufnahme einer gröſseren Brennstoffmenge mit einem centralen Füllschachte versehen.
Mit Hilfe der durchgehenden Spindel B, an welcher unten
ein Kegel C und spiralförmige Schaufeln D befestigt sind, werden die Kohlen o. dgl. regelmäſsig
dem ringförmigen Roste zugeführt. Die Wand des Feuerraumes wird durch einen auch den
unteren Theil des Kessels umgebenden, offenen Vorwärmer G gebildet; die Mitte nimmt ein Chamottestein ein. Die Heizgase gelangen
durch die Röhren in einen ringförmigen Kanal H, aus
welchem sie dann durch zwei Stutzen und ein Querrohr J
entweichen. Der Kessel hat nur sehr kleinen Wasser- und Dampfraum.
So vortheilhaft einerseits das Hindurchführen der Heizrohren durch den Dampfraum in
Hinsicht auf die Gewinnung trockenen Dampfes sein mag, so sind doch andererseits
wegen der schnellen Zerstörung der Röhren die damit verbundenen Nachtheile und
Gefahren so bedeutend, daſs man jetzt möglichst die Röhren im Dampfraume vermeidet
und die Heizgase seitwärts oder auch nach unten aus dem Kessel herausführt, wie dies
die folgenden, fast sämmtlich aus England stammenden Anordnungen
veranschaulichen.
Fig.
6 Taf. 21 zeigt nach dem Engineer, 1882 Bd.
53 S. 292 einen Kessel von D. Midgely in Stanningley
bei Leeds, welcher mit einer hohen cylindrischen Feuerbüchse und einer den Kessel
ringförmig umgebenden Rauchkammer versehen ist. Zwischen beiden sind radial in
groſser Anzahl die kurzen Heizröhren eingesetzt. Der äuſsere Mantel besteht aus
mehreren passend gebogenen Blechplatten, welche mit besonders hergestellten
feuerfesten Ziegeln ausgekleidet und durch Gelenke verbunden sind, so daſs dieselben
behufs Reinigung der Röhren einzeln fortgenommen werden können. Aus der Rauchkammer
entweichen die Heizgase unten, der Feuerthür gegenüber. Der Kessel soll vielfach in
Gebrauch sein.
Der in Fig. 11 und 12 Taf. 21
abgebildete Kessel von W. und J. Beesley in
Barrow-in-Furness (* D. R. P. Nr. 21726 vom 27. Juni 1882) hat Röhren, welche nach
einem Viertelkreisbogen gekrümmt und einerseits in die ebene Decke der Feuerbüchse,
andererseits in die ebene Wand f der seitlich
angehängten Rauchkammer eingerollt sind. Die Röhren liegen in parallelen Ebenen und
sämmtliche Röhren einer Ebene haben denselben Krümmungsmittelpunkt. Durch die der
Rohrplatte f gegenüber liegende groſse Thür sind die
Röhren bequem zugänglich. Die Reinigung wird mit einer an einem starken Stahldrahte
befestigten Bürste bewirkt. Zur Verankerung der vertikalen Rohrplatte dient ein
breites, diametral eingenietetes Blech, mit welchem zugleich die Feuerbüchsdecke wie
die Kesseldecke durch Bolzen verbunden sind. Der Kessel wird nach dem Iron, 1883 Bd. 21 S. 46 in sehr verschiedenen Gröſsen
mit 4 bis 55qm Heizfläche ausgeführt. Der
dargestellte Kessel hat 16qm,35 Heizfläche, 0qm,83 Rostfläche, 2m,75 Höhe und 1m,20 Durchmesser. Die 88
Röhren sind aus weichem Stahl, haben 50mm äuſseren
Durchmesser und 0mm,75 Wandstärke. Für den Kessel
ist ebenfalls Stahlblech benutzt, dessen Dicke im Mantel, der Feuerbüchse und der
Rauchkammer 9mm,5, in der Decke 16mm und in den Rohrplatten 12mm,7 beträgt. Dabei ist eine Betriebsspannung von
etwa 5at zu Grunde gelegt.
G. Hill in Liverpool (* D. R. P. Nr. 20810 vom 28. April
1882) hat dem Kessel die aus Fig. 9 und
10 Taf. 21 ersichtliche Form gegeben. Oberhalb der Feuerbüchse ist, durch
einen kurzen Stutzen mit derselben verbunden, eine trommelförmige Verbrennungskammer
E angeordnet. Von jeder Seite derselben geht ein
Röhrenbündel aus, welches durch einen seitlichen Ansatz B des
Kessels hindurch nach einer Rauchkammer C führt. Die
beiden auf die Kammern C aufgesetzten Schornsteine
können getrennt in die Höhe geführt oder auch vereinigt werden. Es ist hier, wie
ersichtlich, ein Hauptaugenmerk auf eine möglichst gute Verbrennung gerichtet, die
bei den gewöhnlichen Anordnungen, bei welchen die Heizgase aus der Feuerbüchse
direkt in die Röhren eintreten, nicht erreicht wird. Aehnlich wie bei der
Einrichtung von Garrett (1882 244 * 12) wird auch hier durch Röhren G,
welche mit einem Knie durch die Rauchkammern gehen und am unteren Ende mit Klappen
verschlieſsbar sind, Luft in den Verbrennungsraum eingeführt. Der Kessel ist oben
kuppelförmig abgeschlossen und kann eine beliebige Höhe haben. Soll auf demselben
(z.B. bei Anwendung auf Locomobilen) eine Maschine befestigt werden, so wird der
Hauptkörper so niedrig gemacht, daſs er über die Seitentheile B nicht hervorragt. Diese sind dann länger und weiter
zu nehmen, so daſs sie einen genügenden Dampfraum ergeben. – Der Kessel scheint
weniger für den Kleinbetrieb als für mittlere und gröſsere Leistungen bestimmt zu
sein. Bei 3m,3 Höhe, 1m,5 Durchmesser erhält er 95 Röhren von etwa 50mm Durchmesser und soll Dampf für 36e liefern, bei 4m,5 Höhe, 2m,1 Durchmesser und mit 370
Röhren dagegen für 84e ausreichen.
Der in Fig. 7 und 8 Taf. 21
nach Engineering, 1883 Bd. 35 S. 581 abgebildete Kessel
von Sharpe-Palmer, welcher von Abbott und Comp. in Newark gebaut wird, hat eine sehr hohe, fast bis unter
den Wasserspiegel reichende Feuerbüchse, in welche von der Seite ein kegelförmiger
Körper C hineinragt. Durch diesen gehen die Heizröhren
hindurch, welche in eine seitlich angehängte Rauchkammer B führen. Der Körper C steht sowohl auf der
einen Seite, wie auch nach unten und oben mit dem Kesselräume in Verbindung, so daſs
eine stetige Strömung durch diesen Körper, in welchem hauptsächlich die Verdampfung
vor sich geht, stattfinden wird. Ein Schirm verhindert das Emporsprudeln des Wasser-
und Dampfgemisches in den Dampfraum. Die Heizgase sind gezwungen, vor dem Eintritte
in die Röhren zunächst den Körper C zu umspülen, da ein
an denselben sich anschlieſsender halbkreisförmiger Ring aus feuerfesten Ziegeln den
direkten Zutritt versperrt.
Fig.
14 Taf. 21 zeigt nach Engineering, 1883 Bd.
35 S. 491 einen amerikanischen Kessel von J. Souther in
Boston, welcher aus zwei auf einander gesetzten Theilen besteht. Die Decke des
unteren und der Boden des oberen Theiles sind am Rande nach auſsen umgebördelt, in
der Mitte ausgeschnitten und mit je einem kräftigen Ringe C versehen. Auf diese Weise ist zwischen den beiden Theilen eine niedrige
Rauchkammer gebildet, in welche die Heizgase aus der Feuerbüchse durch einen
Doppelkranz kurzer Röhren eintreten, um dann durch einen weiteren Kranz langer
Röhren wieder abwärts zu ziehen und schlieſslich noch den Kesselmantel auſsen zu
umspülen. Durch die gut auf einander abgedichteten Ringe C stehen
die beiden Kesselräume mit einander in Verbindung. Mit einem dieser Oeffnung
entsprechenden Drucke strebt daher auch der Dampf die beiden Theile aus einander zu
treiben und dieser Druck wird von einem einzigen kräftigen Bolzen D, welcher unten an die Feuerbüchsdecke gehängt ist,
aufgenommen.
Im Februar d. J. explodirte ein derartiger, 6 Jahre alter Kessel von 1m Durchmesser und 2m,3 Höhe. Bei der Untersuchung ergab sich, daſs der 50mm starke Bolzen sich aus dem jedenfalls sehr
schlecht aufgeschweiſsten Kopfe, in welchen er 50mm hineinreichte, herausgezogen hatte (vgl. Fig. 13).
Die Sicherheitsventile waren auf 9at belastet.
Derartige Fehler sind um so verhängniſsvoller, als sie durch eine Untersuchung des
Kessels (abgesehen von einer Wasserdruckprobe) nicht aufgefunden werden können.
H. Wilcke in Berlin (* D. R. P. Nr. 22864 vom 19. Januar
1883) gibt die drei verschiedenen in Fig. 15 bis
19 Taf. 21 abgebildeten Kesselformen mit horizontalen Heizröhren an, bei
welchen die Heizgase wieder durch eine seitlich angehängte Rauchkammer abziehen.
Bei Fig. 15 und 16 ist der
untere Theil des mit Unterfeuerung versehenen Kessels behufs Herstellung ebener
Rohrwände abgeplattet. Von dem runden Boden reicht ein Schlammsack F durch den Rost hindurch und in der Achse des Kessels
ist ein Rohr f zur Beförderung eines Wasserumlaufes
eingehängt. Die Heizgase steigen von dem ringförmigen Roste durch einen
halbmondförmigen Spalt zunächst in eine Verbrennungskammer J, welche aus feuerfesten Steinen überhängend an den Kessel angebaut ist,
und treten von hier in die Heizröhren ein.
Wie aus Fig. 17 und
18 zu entnehmen, ist bei der zweiten Ausführung die Kammer J in den Kessel eingebaut. Der mittlere Schuſs des
Mantels hat einen um so viel gröſseren Durchmesser als der obere und untere, daſs er
auf der abgeflachten Seite hinter diesen nicht zurücktritt. Der untere, die
Feuerbüchse bildende Theil des Mantels ist ausgemauert.
In Fig. 19 endlich ist der mittlere Querschnitt wieder beiderseits
abgeflacht, wie bei Fig. 15;
derselbe ist hier aber, um die Herstellung der Kesselwandung zu erleichtern, nach
oben und unten allmählich in den Kreisquerschnitt übergeführt. Die kegelförmige
Feuerbüchse ist wie gewöhnlich von einem Wassermantel umgeben und die Kammer J wie bei Fig. 15
angehängt.
(Schluſs folgt.)