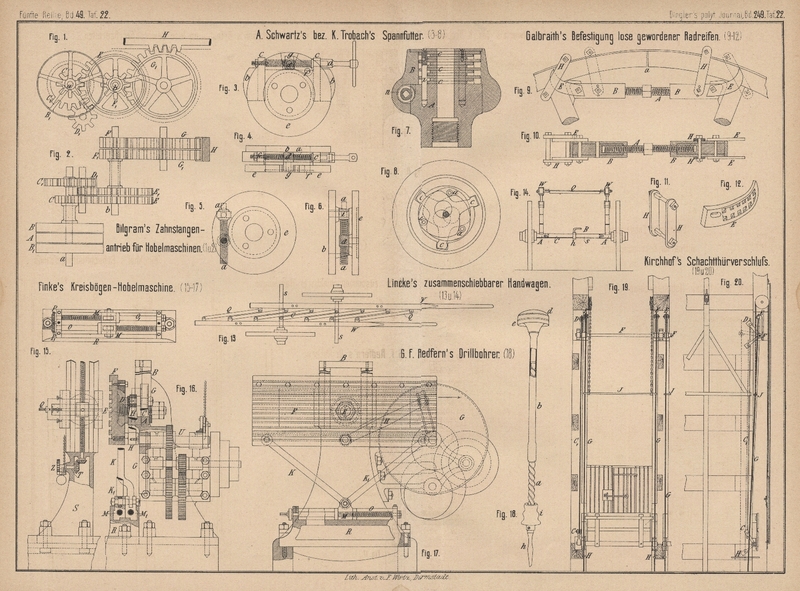| Titel: | H. Bilgram's Zahnstangenantrieb für Hobelmaschinen. |
| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 326 |
| Download: | XML |
H. Bilgram's Zahnstangenantrieb für
Hobelmaschinen.
Mit Abbildungen auf Tafel 22.
Bilgram's Zahnstangenantrieb für Hobelmaschinen.
Im Journal of the Franklin Institute, 1883 Bd. 115 S.
476 wird über eine recht zweckmäſsige, von H. Bilgram
angegebene Anordnung des Zahnstangen-Antriebes für Hobelmaschinen berichtet, bei
welchem jeder todte Gang zwischen den Zähnen des Räderwerkes und der daraus bei
Bewegungsumkehr des Schlittens erwachsende Stoſs vermieden ist (vgl. Hasses hydraulischen Antrieb 1883 247 * 444). Dieser Vortheil wird erreicht durch die Anwendung zweier
vollständig getrennter Rädergetriebe, von denen das eine nur den Vorlauf, das andere
den Rückgang des Schlittens bewirkt, wobei die arbeitenden Zahnflächen stets in
Berührung bleiben.
In Fig.
1 und 2 Taf. 22
ist dieser Mechanismus in Ansicht und Grundriſs schematisch dargestellt. Die
Bewegung wird vom Vorgelege durch einen einzigen Riemen übertragen, welcher bei
jeder Bewegungsumkehr des Schlittens in bekannter Weise selbstthätig von der
Triebscheibe B für den Vorlauf auf die Festscheibe B1 für den Rücklauf und
umgekehrt verschoben wird. Zwischen den Scheiben B und
B1 befindet sich
die Losscheibe A. Die Vorlaufscheibe B bildet mit dem kleinen Stirnrade C ein Stück und rotirt mit demselben um die Welle a, welche die Rücklaufscheibe B1 trägt. Das Getriebe C versetzt nun mittels des auf der Zwischenwelle b festgekeilten Rades E
diese Welle und das auf ihr sitzende Rad F in Drehung.
Letzteres überträgt die Bewegung mittels des Zwischenrades G auf die Zahnstange H.
Das auf der Hauptwelle a aufgekeilte Zahnrad C1 bewegt, wenn der
Riemen auf der Rücklaufscheibe B1 liegt, mittels des eingeschalteten Rades D1 das Rad E1; dieses ist mit
seiner verlängerten Nabe, welche die Welle b
concentrisch umgibt, im Gestelle der Maschine gelagert und bildet mit dem Getriebe
F1 ein Ganzes. Von
F1 geht die
Bewegung über G1 auf
die Zahnstange H über, welche auf die Weise
entgegengesetzt verschoben wird, da das Zahnradsystem für diesen Rücklauf eine Achse mehr enthält
als das für den Vorlauf. Was nun das Verhältniſs der Schlittengeschwindigkeit für
Arbeite- und Leergang anbetrifft, so ist dasselbe bei der skizzirten Anordnung, wo
die Räder F und F1 bezieh. E und E1 dieselben
Zähnezahlen besitzen, gleich dem Verhältnisse der Zähnezahlen von C und C1.
Beim Vorgange des Schlittens wird nun mittels der Zahnstange H das ganze Rädersystem B1 bis H in der dem
Leergange entgegengesetzten Bewegungssinne mitgenommen. Es liegen daher alle Zähne
dieses Systemes schon mit denjenigen Flanken an, welche während des
Schlittenrückganges, wenn der Riemen auf B1 geschoben ist, sich berühren müssen. Ein todtes
Spiel zwischen den Rädern tritt also beim Bewegungswechsel nicht ein. Ganz ebenso
verhält es sich beim Umsteuern der Maschine zu Ende des Leerlaufes.
Die Vorzüge dieses Antriebsmechanismus veranlaſsten den zur
Beurtheilung seitens des Franklin Institute bestellten
Ausschuſs, die Verleihung eines Preises und einer Medaille der Scott'schen Stiftung für denselben zu befürworten.
Tafeln