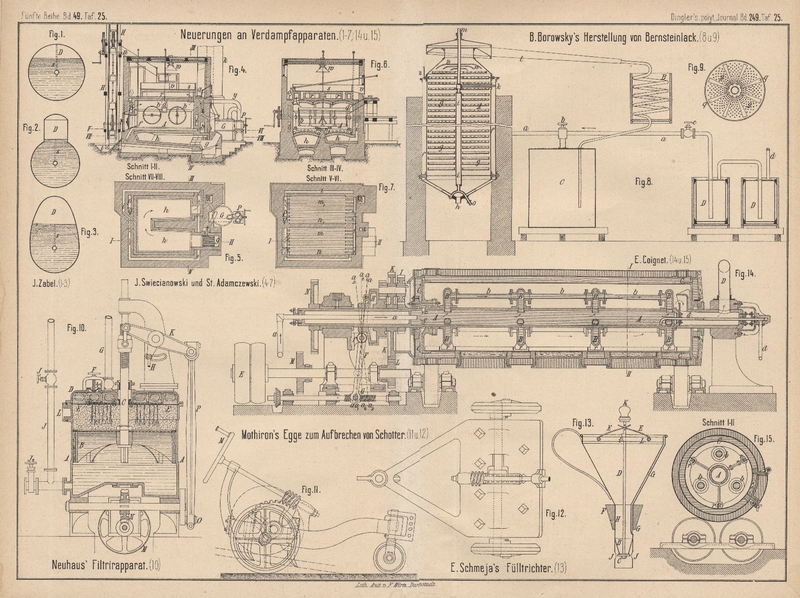| Titel: | Ueber Neuerungen an Verdampfapparaten. |
| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 371 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an
Verdampfapparaten.
Mit Abbildungen auf Tafel 25.
Ueber Neuerungen an Verdampfapparaten.
Nach J. Zabel in Schönebeck a. Elbe (* D. R. P. Kl. 62
Nr. 21883 vom 13. September 1882) ist das Verdampfungsgefäſs des Piccard'schen Apparates (vgl. 1879 231 * 65. * 211) cylindrisch, hat daher, da es nicht ganz
mit Soole gefüllt ist, einen Dampfraum D (Fig.
1 Taf. 25). Die Schaufeln und Schnecken s
durchziehen diesen Dampfraum bei jeder Umdrehung etwa zur Hälfte und überziehen sich
hierbei jedesmal mit einer dünnen Salzschicht, welche nach mehrtägigem Betriebe zu
einem harten und starren Salzsteine anwächst, der sich dann leicht stückweise
ablöst. Solche Stücke fallen, wenn sie durch das Rührwerk günstig erfaſst werden,
mit dem Salze durch das Salzabfallrohr, können aber auch leicht Brüche zur Folge
haben.
Um diesem Uebelstande abzuhelfen, soll man nach Zabel
die sich drehenden Schaufeln und Schnecken unter den Soolspiegel verlegen, was
dadurch erreicht wird, daſs man ein cylinderförmiges Gefäſs entweder ganz mit Soole anfüllt und in
seiner ganzen Länge mit einem Dome als Dampfraum versieht (Fig. 2),
oder dadurch, daſs man dem Gefäſse einen länglich runden Querschnitt gibt, am besten
aber der gröſseren Widerstandsfähigkeit wegen den eines Eies, mit der Spitze nach
oben (Fig. 3).
J. Swiecianowski und St.
Adamczewski in Warschau (* D. R. P. Kl. 62 Zusatz Nr. 20392 vom 18. Mai
1882) versehen das in dem unteren Theile des Ofens in einem völlig geschlossenen
Räume angebrachte Abdampfgefäſs A (Fig. 4 bis
7 Taf. 25) mit Rührwerk b, welches von Hand
oder mechanisch bewegt wird. Das Gefäſs wird durch das Rohr d beschickt und durch den Schieber f
entleert. Die Verbrennungsgase gehen vom Feuerraume g
aus durch den Kanal h, dann durch den Kanal i, welcher in dem das Gefäſs A umgebenden Mauerwerke angebracht ist, nach dem Schornsteine k. Zur Unterstützung der Abdampfung tritt Luft in das
über dem Feuerkanale h liegende Rohrsystem m, geht durch den oberen Theil des Kanales o, das Rohrbündel m1 und durch den senkrechten Kanal p nach dem Abdampfraume. Die für den Trockenraum
bestimmte Luft geht dagegen durch die Rohre n, den
unteren Theil des Kanales o und Rohr n, nach dem senkrechten Kanale q, um von hier aus in den Trockenraum zu gelangen.
Die in den Abdampfraum geleitete heiſse Luft geht mit den hier entwickelten Dämpfen
und Gasen durch den unter der Darre s liegenden Kanal
r in den Schornstein k, wenn die Klappe a geöffnet ist. Ist dieses
nicht der Fall, so gelangen die Gase entweder in den zur Feuerung führenden Kanal
z oder durch Rohr y
nach der Pumpe P. Durch die letztere werden die Gase in
das Absorptions- oder Waschgefäſs G und durch die in
demselben befindliche Flüssigkeit getrieben. Die so gewaschenen Gase können nun
entweder durch Kanal z in die Feuerung, oder in den
Schornstein k geleitet werden, je nachdem sie noch
brennbare Bestandtheile enthalten oder nicht. Der Inhalt des Waschgefäſses G richtet sich nach der Beschaffenkeit der in dem
Apparate behandelten Substanzen. Sollen z.B. Fäcalien
eingedampft und getrocknet werden, so wird man verdünnte Schwefelsäure zur
Absorption des Ammoniaks anzuwenden haben.
Die im Gefäſse A eingedampften Stoffe fallen nach
Oeffnung des Schiebers f in die Grube f, um von dem Aufzuge H
nach oben befördert zu werden und durch das Rohr u auf
die Darre s zu fallen. Die hier entwickelten Gase
entweichen in den Schornstein oder durch den Schlot w,
während die getrockneten Stoffe durch die Oeffnung v
entfernt werden.
E. Coignet in Paris (* D. R. P. Kl. 82 Nr. 21895 vom 28.
Juli 1882) läſst den zum Heizen seines Abdampfapparates bestimmten Dampf durch das
Rohr a (Fig. 14 und
15 Taf. 25) in die Hohlwelle A eintreten und
von hier in die hohlen, mit Schabern r versehenen
Scheiben B und die als Rührer dienenden Rohre b, auſserdem durch Oeffnungen c in den Dampfmantel C. Das
Condensationswasser flieſst in die Welle A zurück und wird durch das
Syphonrohr d nach auſsen geleitet. Der ganze Cylinder
ist noch von einer äuſseren Luftkammer umgeben, welche die Wärmestrahlung nach
auſsen möglichst verhindert.
In den verschiedenen Figuren sind die Luftkammern durch senkrechte, die Dampfräume
dagegen durch wagrechte Schraffirungen angedeutet. Die Verdampfungsgase nehmen ihren
Weg in der Richtung der punktirten Pfeile und entweichen durch einen in der
Verlängerung der Welle A liegenden mittleren Kanal und
durch das Rohr D, in dessen Verlängerung sich eine
Saugvorrichtung befindet, welche die Abdampfung befördert. Die abgezogenen Gase
werden unter eine Feuerung geführt und dann verbrannt oder auf andere Weise
unschädlich gemacht bezieh. verwerthet.
Die Welle A und der Cylinder C erhalten von der gemeinsamen Riemenscheibe E aus ihre Bewegung. Der Hebel F, welcher
sich um den festen Punkt f dreht und durch die Schraube
G seine Bewegung erhält, bewirkt die Ein- und
Auslösung der Reibungsscheibe H. Das Zahnrad K wird durch das Getriebe L (wenn dieses sich in der in der Zeichnung angegebenen Stellung befindet)
gedreht. Desgleichen wird bei entsprechender Stellung des Hebels F das Rad N von dem Rade
M bewegt. Endlich hat noch das auf seiner Achse
feste Getriebe I zum Rade K eine planetare Bewegung und, wenn die Scheibe H eingeschaltet ist, erhält die Welle A von
diesem Getriebe I eine dem Cylinder C entgegengesetzte Drehung. Befindet sich der Hebel F in der Stellung a (Fig.
14), so drehen sich Cylinder und Welle; bei der Stellung a1 dreht sich der
Cylinder allein, bei a2
stehen beide still und bei der Stellung a3 bewegt sich die Welle allein.
Tafeln