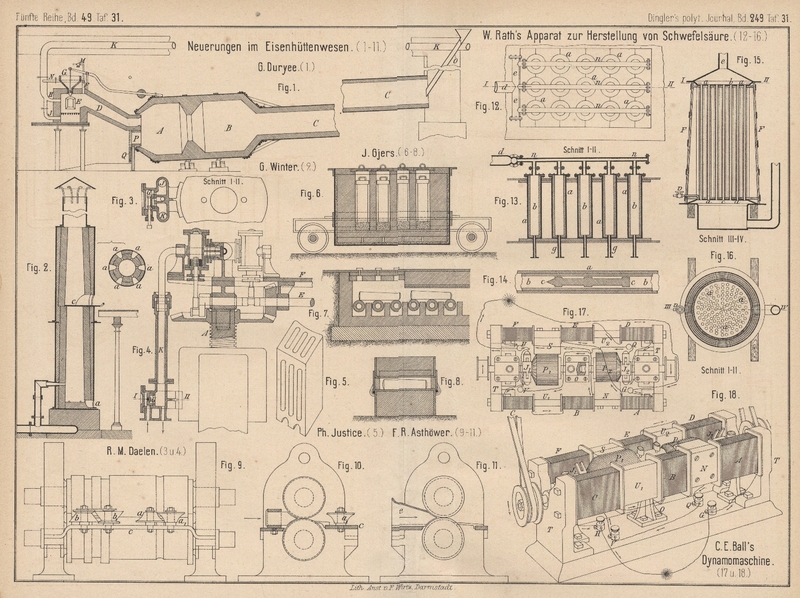| Titel: | C. E. Ball's unipolare Dynamomaschine. |
| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 452 |
| Download: | XML |
C. E. Ball's unipolare
Dynamomaschine.
Mit Abbildungen auf Tafel 31.
C. E. Ball's unipolare Dynamomaschine.
Eine Dynamomaschine, welche die eigenthümliche, von den sonst bekannten Maschinen
abweichende Anordnung zeigt, daſs ihre Armaturen in dem Felde nur je eines einzigen
Magnetpoles rotiren, wird von C. E. Ball in
Philadelphia (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 19855 vom 28. Januar 1882) gebaut. Wie aus Fig.
17 und 18 Taf. 31
hervorgeht, besteht diese Maschine aus einem langen, rechteckigen Rahmen aus weichem
Eisen, der so mit Draht bewickelt ist, daſs er die erregenden Magnete für zwei Pacinotti'sche Ringe P1, P2 bildet, deren Achsen in den Rahmenschenkeln T sowie in einem mitten auf der Grundplatte der
Maschine stehenden Bocke O gelagert sind. Auf jeden
Ring wirkt aber nur ein einziger schuhförmiger Magnetpol N bezieh. S, da ihm gegenüber eine neutrale
Stelle U1, U2
des magnetischen Feldes
liegt. Die 6 Spulen machen also aus dem Rahmen zwei lange Elektromagnete mit zwei
ungleichen Polen S und N,
anstatt vier kurzer und entsprechend schwächerer mit 4 Polen, von denen je zwei auf
einen Ring wirken. Der Stromlauf geht von G durch die
Spulen A, E, D nach der unteren Bürste des
Stromsammlers J2 des
Ringes P2, von der
oberen Bürste desselben über Q und V zur unteren Bürste des Stromsammlers J1 des Ringes P1 und von dessen
oberer Bürste durch die Spulen C, B, F nach H; in G und H schlieſst sich der äuſsere Stromkreis an. Wird die
Bewickelung so angeordnet, daſs zwei gleichnamige Pole entstehen, so müssen die
beiden Ringe im gleichen Sinne rotiren und können dann auch auf eine
gemeinschaftliche Achse aufgesteckt werden. Versuche, welche R. Sabine mit dieser Maschine angestellt hat, lassen dieselbe ebenso
leistungsfähig erscheinen wie die Maschinen, auf welche während der Pariser
Ausstellung 1881 die Messungen (vgl. 1883 248 205)
erstreckt wurden.
Nach dem Engineer, 1883 Bd. 53 * S. 244 ist eine solche
Maschine, welche jetzt in Kirby Street, Hatton Garden, in London aufgestellt ist, in
New-York und London während des gröſsten Theiles der letzten 12 Monate in Betrieb
gewesen, ohne daſs Ausbesserungen nöthig geworden wären. Dies verdankt sie ihrer
einfachen Construction. Die Riemen sind sehr schmal (12 bis 19mm) und 6mm
dick; die Riemenscheiben haben 200mm Durchmesser.
Die Spannung eines jeden Riemens beträgt bei 1700 Umdrehungen in der Minute und
einem Kraftverbrauche von 5e,76 nur 12k,1.
Eine neuere Maschine Ball's, welche in Engineering, 1883 Bd. 35 * S. 306 abgebildet ist, zeigt
nur constructive Abweichungen. Bei ihr erstreckt sich die Bewickelung auch über die
neutralen Stellen des Rahmens hinweg.
Tafeln