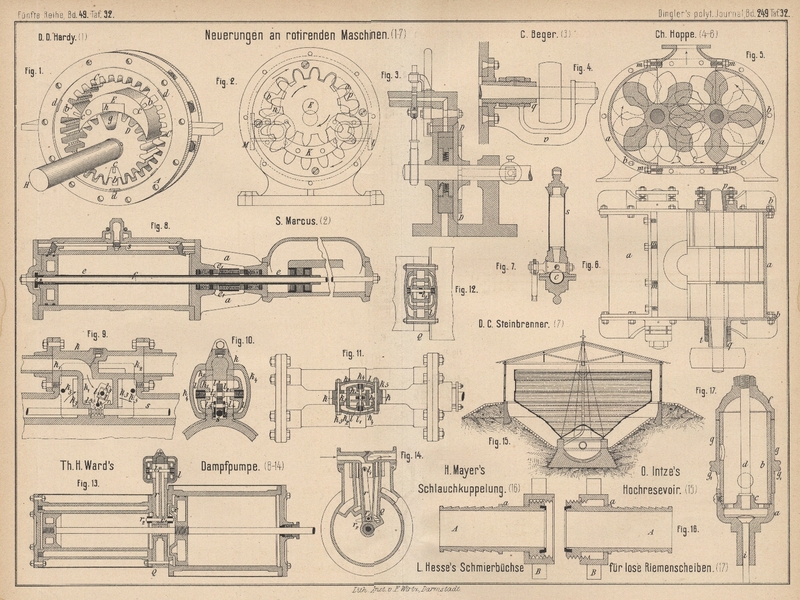| Titel: | Neuerungen an rotirenden Maschinen. |
| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 478 |
| Download: | XML |
Neuerungen an rotirenden Maschinen.
Patentklasse 59. Mit Abbildungen auf Tafel 32.
Neuerungen an rotirenden Maschinen.
Der rotirende Motor von Dexter
D. Hardy in Chicago (* D. R. P. Nr. 21195 vom 11. Mai 1882) besteht aus
einem cylindrischen Gehäuse A mit 2 Deckeln. (Die
Skizze Fig. 1 Taf. 32 zeigt die Maschine mit abgenommenen Deckeln.) Innerhalb
dieses Gehäuses rotirt ein Zahnkranz C mit
Innenverzahnung, so daſs die Kopfflächen dampfdicht an den Deckeln vorbeischleifen.
In dem Zahnkranze C sind drei groſse Zähne b angeordnet, welche an der Krone mit Dichtungsstücken
c versehen sind. Mit der Innenverzahnung des
Kranzes C steht ein kleineres Zahnrad D in Eingriff, welches entsprechend den drei groſsen
Zähnen b des Zahnkranzes C
zwei groſse Zahnlücken g besitzt. Dieses Rad D ist auf einer Welle H
aufgekeilt, welche excentrisch durch die beiden Deckel der Maschine hindurchgeführt
und in denselben gelagert ist. Zwischen Zahnkranz C und
dem Zahnrade D liegt nun ein sichelförmiges Stück E, welches mit den beiden Deckeln verschraubt wird,
oben eine mit dem Zahnkranze C, unten eine mit dem
Zahnrade D concentrische Begrenzungsfläche besitzt, so
daſs die groſsen Zähne b des Zahnkranzes und die Zähne
des Zahnrades dampfdicht an dem Stücke E
vorbeischleifen. Die Dichtung zwischen D und E wird noch durch die Einlage h gesichert.
Führt man nun in den Raum rechts von D Dampf ein, so
schiebt dieser, indem er auf den rechten groſsen Zahn b
drückt, den Zahnkranz nach links herum und dreht so das Rad D bezieh. die Welle H mit einer vergröſserten
Geschwindigkeit in derselben Richtung. Um einen einseitigen Druck des Dampfes auf
den Zahnkranz und damit einen schnellen Verschleiſs der reibenden Flächen zu vermeiden,
entlastet man den Zahnkranz in der Weise, daſs man in den Umfang desselben
Dichtungsstreifen d einlegt und das zwischen denselben
liegende Material bis auf eine gewisse Tiefe wegnimmt. Verbindet man nun die
Dampfräume der Maschine mit diesen Hohlräumen durch Oeffnungen, so wird der
Zahnkranz entlastet.
Die Maschine von Siegfr. Marcus in Wien (* D. R. P. Nr.
21413 vom 22. Juli 1882) gleicht der eben beschriebenen Maschine auf den ersten
Blick auſserordentlich; sie beruht jedoch auf einem ganz anderen Prinzipe. Bei
genauerem Vergleiche der Fig. 2 Taf.
32 mit Fig. 1 bemerkt man nämlich, daſs dem Zahnkranze sowohl, wie dem Zahnrade
die groſsen Zähne bezieh. die groſsen Zahnlücken fehlen. Damit nun trotzdem eine
Bewegung der Räder eintreten könne, wird der bei L
eingeleitete Dampf durch in den Deckeln der Maschine angeordnete Aussparungen p zwischen die rechtsseitigen geschlossenen Zahnlücken
a der in Eingriff stehenden Zähne geleitet. Hier
expandirt der Dampf und drückt die Zähne aus einander, was eine Drehung der Räder
von links nach rechts zur Folge hat. Der zwischen den Zahnlücken des Zahnrades
bezieh. des Zahnkranzes und dem Einsatzstücke K
befindliche Dampf wird dabei nach links zur Ausströmung M geleitet. Dahin gelangt auch der zwischen den linksseitigen
geschlossenen Zahnlücken b stehende Dampf durch die
Aussparung n.
Beide vorbeschriebenen Maschinen können durch Vertauschung der Dampf-Einström- und
Ausströmkanäle ihre Drehungsrichtung wechseln. Läſst man eine äuſsere Kraft auf die
Wellen H (Fig. 1)
bezieh. E (Fig. 2)
wirken, so können die Maschinen als Pumpen, Ventilatoren und Exhaustoren Verwendung
finden. Es sei noch bemerkt, daſs die Maschine Fig. 2
groſse Mengen Dampf verbraucht.
Die Dichtung der reibenden Flächen ist einer der
gröſsten Mängel der rotirenden Maschinen. Verschiedene Vorschläge sind auf die
Aufhebung dieses Uebelstandes gerichtet. Fr. Strohmayer
und W. Kumpfmiller in München (* D. R. P. Nr. 11649 vom
19. Mai 1880) ordnen innerhalb des Gehäuses der rotirenden Maschine einen sich der
Gestalt des Gehäuses anpassenden Einsatz an, innerhalb welchem die arbeitenden
Theile liegen. Dieser Einsatz wird in der Mitte, senkrecht zur Achse der arbeitenden
Theile, durchschnitten und werden die Schnittflächen mit Zähnen versehen, welche
kammartig in einander greifen. Ist nun an den Kopfflächen der arbeitenden Theile
eine Dichtung nicht mehr vorhanden, so schiebt man die beiden Hälften des Einsatzes
zusammen, bis sie wieder auf den Kopfflächen der arbeitenden Theile aufliegen und
diese sich in die Innenflächen des Einsatzes einarbeiten können.
Aehnlich ist die Dichtung von C.
Beger in Berlin (* D. R. P. Nr. 22833 vom 18. November 1882); nur ist hier
ein Deckel des Gehäuses fest mit der rotirenden Walze verbunden und schleift auf dem
ventilsitzartig ausgearbeiteten Gehäuserande. Da der Typus der rotirenden Maschine unwesentlich
ist, so soll die Einrichtung nur an einem Querschnitte erläutert werden. Wie aus
Fig. 3 Taf. 32 ersichtlich, ist hier neben der Walze f die Scheibe D fest auf
die Treibwelle aufgekeilt und letztere auf ihren am Gehäuse befindlichen Sitz
dampfdicht aufgeschliffen. Dasselbe gilt von der Berührungsfläche der linken
Kopfseite der Walze mit dem linken Gehäusedeckel. Um nun diese Dichtung während des
Betriebes zu erhalten, wird D durch irgend welche
Mittel, z.B. durch mittels Gewichtshebel belastete Schrauben, Federn o. dgl., gegen
das Gehäuse gedrückt. Hierdurch wird allerdings eine Dichtung erzielt, aber auf
Kosten der leichten Gangbarkeit.
Während diese Patente Vorrichtungen betreffen, um die Dichtung in achsialer Richtung
herzustellen, bezweckt die Erfindung von Ch. Hoppe in
Bockenheim bei Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 21998 vom 12. Juli 1882 als Zusatz zu
Nr. 19147) eine Dichtung in radialer Richtung.
Fig.
5 und 6 Taf. 32
zeigen die Einrichtung an einem Pappenheim'schen
Kapselwerke angebracht. Die beiden halbkreisförmigen Seitentheile a des Gehäuses sind gegen die Deckel verschiebbar
angeordnet, was durch ovale Bolzenlöcher b in letzteren
erreicht wird. Die Einstellung der Seitentheile geschieht durch die Schrauben m, welche je nach dem Verschleiſse der reibenden
Flächen angezogen werden können. Um auch die Räder achsial und radial einstellen zu
können, sind die Achsschenkel derselben conisch gestaltet. Dieselben laufen in
Büchsen p (Fig. 6), an
deren Flanschen Schrauben mit schwalbenschwanzförmigen Köpfen angeordnet sind.
Letztere fassen in eine Kreisnuth im Gehäusedeckel von ebenfalls
schwalbenschwanzförmigem Querschnitte ein. Man kann also durch Lösen der Muttern der
Schraubenbolzen die Büchse p radial und durch Anziehen
der Muttern und Gegenmuttern der Büchse dieselbe achsial verstellen. Auf der unteren
Seite der Fig. 6 ist
die Büchse q in ein am Gehäusedeckel befestigtes
Wandlager t geschraubt und durch Mutter und Gegenmutter
darin festgestellt.
Für gröſsere Maschinen soll sich die in Fig. 4
gezeichnete Anordnung empfehlen. Wie ersichtlich, ist hier die Welle an 2 Stellen in
einem Wandlager v gelagert; letzteres ist durch
schwalbenschwanzförmige Schraubenköpfe und eine ebensolche Kreisnuth radial
verstellbar, während die conische Büchse q durch Mutter
und Gegenmutter in dem einen Lager achsial einstellbar ist.
In dem Hauptpatente Hoppe's (* D. R. P. Nr. 19147 vom
27. Oktober 1881) wird eine höchst einfache, aber, wie es scheint, doch
wirkungsvolle Schmiervorrichtung für rotirende,
besonders schnellgehende Maschinen erwähnt. Die Flügel sind hohl und mit einem
Schmiermittel von einer zu erprobenden Zähigkeit angefüllt. An den Spitzen der
Flügel sind Austrittsöffnungen für die Schmiere angeordnet, so daſs dieselbe durch
die Centrifugalkraft gegen die Oeffnungen gedrückt wird und die gebogenen Wände des
Gehäuses schmiert.
D. C. E. Steinbrenner in Aarhuus, Dänemark (* D. R. P.
Nr. 22220 vom 12. September 1882) schmiert die
rotirenden Maschinen dadurch, daſs er in das Dampfzutrittsrohr eine besondere
Vorrichtung (Fig. 7 Taf.
32) einschaltet. Dieselbe besteht aus einem über dem Dampfrohre c angeordneten Schmiergefäſse s, welches durch einen Kanal mit dem Dampfrohre in Verbindung steht. In
diesem Kanäle ist ein voller drehbarer Hahnkegel eingeschaltet, in dessen
Mantelfläche sich Aussparungen befinden. Dreht man nun den Hahnkegel, z.B. von der
Treibwelle der Maschine aus, so bringt derselbe die sich in die Aussparungen
festsetzenden Schmiertheile in das Dampfrohr, worauf dieselben vom durchströmenden
Dampfe mit in den Arbeitsraum der Maschine gerissen werden.
Tafeln