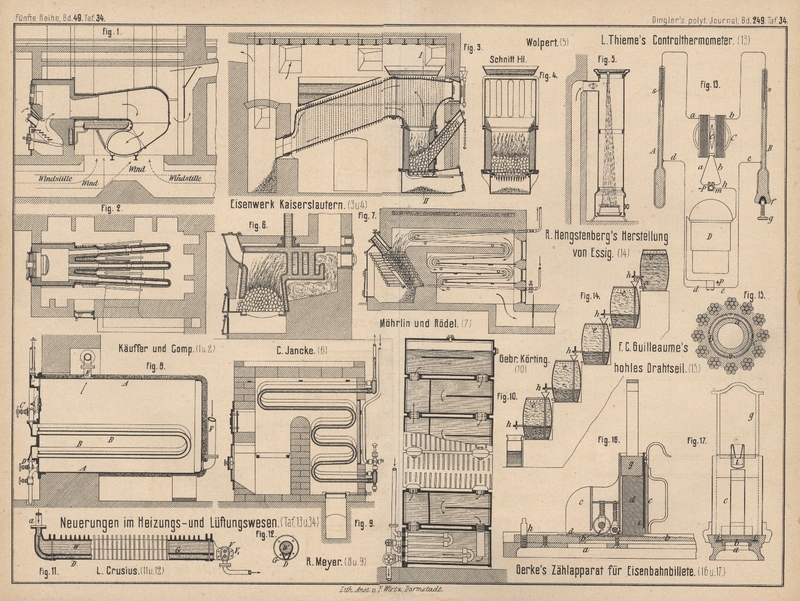| Titel: | Controlthermometer von L. Thieme in Dresden. |
| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 504 |
| Download: | XML |
Controlthermometer von L. Thieme in
Dresden.
Mit Abbildung auf Tafel 34.
Thieme's Controlthermometer.
Werden nach L. Thieme in Dresden (* D. R. P. Kl. 42 Nr.
22055 vom 30. August 1882) zwei Quecksilberthermometer A und B (Fig. 13
Taf. 34) in einen elektrischen Stromkreis so eingeschaltet, daſs durch die
Quecksilberfäden der Thermometer der Strom geschlossen ist, so wird eine Magnetnadel
c, wenn der eine Leitungsdraht a um die Nadel rechts, der andere b links gewunden ist, nicht aus der Richtung des
Erdmeridians abgelenkt, vorausgesetzt, daſs die Leitungswiderstände in beiden
Zweigen +PBC – P und –PCA +
P gleich groſs sind. Aendert sich jedoch die Länge eines Quecksilberfadens
in dem eingeschalteten Thermometer, so bedingt dies die Störung des Gleichgewichtes
in der Ablenkung der Nadel durch den galvanischen Strom und die Nadel strebt eine
andere Gleichgewichtslage zu gewinnen, welche abweichend von der Richtung des
Meridians ist. Die Nadel kehrt wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück, sobald
(vorausgesetzt, die Querschnitte der Fäden seien gleich) die Länge des
Quecksilberfadens in dem anderen Thermometer genau dieselbe Gröſse erhält.
Thieme führt nun oberhalb des Quecksilbers in die
Thermometer eine Spirale s aus feinem Drahte ein,
welche mit einem Ende in das Glas der Thermometerröhre eingeschmolzen, mit dem
anderen Ende auf einem Eisenstäbchen befestigt ist, das auf dem Quecksilber
schwimmt. Die Glaskugel des Thermometers B ist unten
offen und hier durch einen Beutel f, auf welchen eine
Schraube g wirkt, geschlossen. Der eine Pol des
galvanischen Elementes D bildet eine Feder h, die auf das Metallstück m, von welchem die Leitungsdrähte a und b der Zweige asd und bse ausgehen, niedergedrückt wird, wenn an der Bussole
C abgelesen werden soll, ob die Fadenlängen in
beiden Thermometern übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wird die Nadel durch
den Contact der Feder h mit dem Klötzchen m aus ihrer Ruhelage gebracht, so regulirt man die
Schraube g so lange, bis die Nadel in der Bussole
wieder zur Ruhe gelangt, und liest dann am Thermometer B die Temperatur ab, welche A miſst.
Dieses Verfahren soll dazu dienen, um an einer Centralstelle, wo das Thermometer B, die Bussole C und das
Element D aufgestellt wird, die Temperatur an entfernt
gelegenen Orten, wo Thermometer A zur Aufstellung
gelangen, abzulesen, so in Krankenhäusern, in Krankenzimmern, ferner beim Gebrauche
der Thermometer an Kranken, ohne dieselben in ihrer Ruhe durch eine
Temperaturermittelung zu stören, in Gärtnereien u.s.w. – Ob es hierzu hinreichend
empfindlich und zuverlässig ist, muſs durch Versuche festgestellt werden.
Tafeln