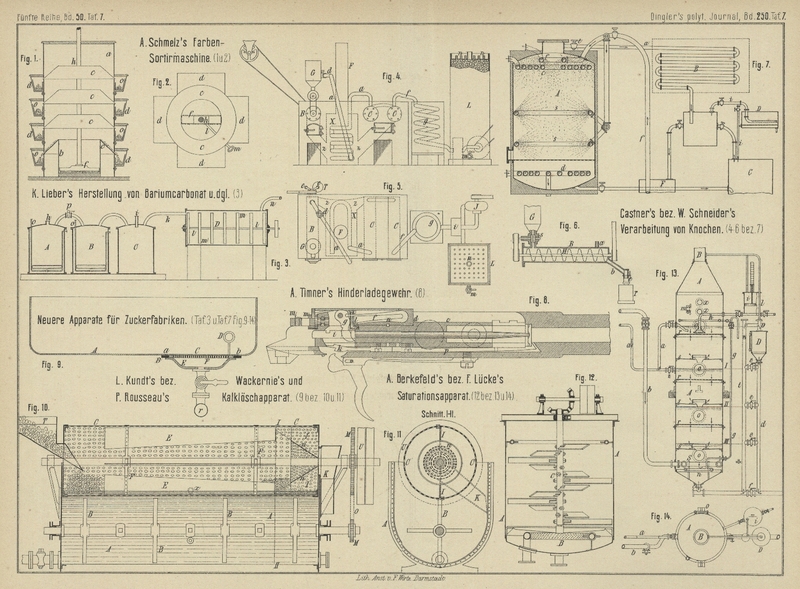| Titel: | Apparate zur Verarbeitung von Knochen. |
| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 70 |
| Download: | XML |
Apparate zur Verarbeitung von
Knochen.
Mit Abbildungen auf Tafel 7.
Apparate zur Verarbeitung von Knochen.
Um bei der Verkohlung von Knochen mehr Ammoniak und eine
bessere Knochenkohle zu bekommen, soll man nach H. Y. und E.
B. Castner in New-York (* D. R. P. Kl. 89 Nr. 22948 vom 6. September 1882)
die zerkleinerten Knochen ununterbrochen durch einen heiſsen Cylinder hindurchführen
und unter Luftabschluſs erkalten lassen, die aus dem Glühcylinder angesaugten Gase
aber mit Luft vermischt durch heiſse Röhren und dann über erhitzten Kalk leiten, um
sie nach dem Abkühlen mit einer Säure zusammenzubringen.
Die Feuerung des Glühcylinders B (Fig. 4 bis
6 Taf. 7) und die der beiden Cylinder C sind
durch Rauchzüge z mit einer mittleren Kammer X verbunden, aus welcher die Feuergase zum Schornsteine
F entweichen. Die zerkleinerten Knochen werden aus
dem Behälter G mittels Zuführungswalze s in den Glühcylinder geschafft, in diesem durch
Schnecke H an das andere Ende geschoben, wo die
Knochenkohle in einen dicht verschlossenen Behälter T
fällt. Um den Betrieb ununterbrochen fortsetzen zu können, bringt man an der
Ableitungsröhre b zwei Rohrarme e an, von denen ein jeder mit einer Kuppelung versehen ist, durch welche
seine Verbindung mit dem Behälter T ermöglicht wird.
Ist einer der Behälter gefüllt, so wird er fortgenommen und entleert, während die
Kohle nach dem zweiten Behälter geführt wird.
Die im Glühcylinder entwickelten Gase werden durch Rohr a abgesaugt, in welches bei d atmosphärische
Luft eintritt. Das Gasgemisch geht durch das im Heizraume X liegende Schlangenrohr, wodurch die Kohlenwasserstoffe oxydirt und die
Stickstoffverbindungen auf eine einfachere Form reducirt werden sollen. Die Gase
treten dann in die Behälter C, welche gelöschten, hoch
erhitzten Kalk enthalten, damit die Stickstoffgase durch den Wasserstoff des durch
die Kohlensäure sich zersetzenden Kalkhydrates in Ammoniak übergeführt werden. Von
hier gehen die Gase durch Rohr f und die Kühlschlange
g, damit sich die Wasserdämpfe verflüssigen und mit
dem verhandenen kohlensauren Ammoniak im Behälter i
sammeln, während die Gase durch Gebläse J in den Thurm
L gedrückt werden. In diesem ist Koke oder anderes
passendes Material, wodurch das Gas nach aufwärts streichen kann, aufgeschichtet.
Durch diese Masse flieſst durch Rohre n Schwefelsäure
oder Salzsäure von mäſsiger Concentration nach abwärts, wobei das Ammoniakgas in
Ammoniumsulfat oder Chlorid übergeführt wird und in Lösung durch einen Hahn m abgelassen werden kann. Das durch die Säure seines
Ammoniakgehaltes beraubte Gas entweicht oben aus dem Thurme in die Luft und die
durch den Hahn m abgelassene Säurelösung wird in den
Thurm zurückgepumpt, um darin wieder herabflieſsen und noch mehr Ammoniak aufnehmen
zu können.
Nach Werner Schneider in Lehrberg bei Ansbach (* D. R.
P. Kl. 23 Nr. 22295 vom 31. Mai 1882) wird zum Entfetten von
Knochen und anderen Stoffen unter Druck nach Einfüllung der zu entfettenden
Stoffe in den Apparat A (Fig. 7 Taf.
7) derselbe zu etwa ⅘ seines Inhaltes aus dem Behälter C mit Benzin o. dgl. gefüllt und dieses durch Einleiten von Dampf in die
Schlange d zum Sieden erhitzt. Sobald durch Rohr a Benzindämpfe übergehen, schlieſst man den Hahn e und preſst mit mindestens 1at Ueberdruck aus dem Behälter F durch Rohr f und
seitliche Brausen s Benzin nach A, so daſs dasselbe die erwärmten Knochen u. dgl. umspült. Wird nun nach
10 bis 15 Minuten der Hahn e wieder geöffnet und der
Apparat erwärmt, so destillirt ein Theil Benzin durch den Condensator B nach dem Apparate F
über. Dasselbe wird sodann wieder nach A gedrückt und
ausgebraust und dieser Vorgang abwechselnd mehrfach fortgesetzt; jedoch erhöht man
bei jeder Wiederholung der Ueberbrausung den Druck im Gefäſse A und natürlich noch mehr in dem Benzinhilfsgefäſse F, bis man zuletzt mit etwa 2at Ueberdruck das Benzin eintreibt. Dieser
allmählich wachsende Druck bewirkt ein gesteigertes Auswaschen und Tiefertreiben der
Benzinflüssigkeit in die Poren der Knochen hinein. Hierbei wirkt besonders die
Erhitzung der Knochen durch die Benzinverdampfung und die darauf folgende Bebrausung
und Umspülung mit kaltem Benzin. Die Wirkung des Benzinregens kann dadurch verstärkt
werden, daſs man das Schlangenrohr c von kaltem Wasser
durchflieſsen läſst.
Nach Beendigung dieser Behandlung wird das Benzin wie gewöhnlich durch Wasserdampf
abgetrieben und durch die Kühlschlange B nach F und C überdestillirt. Um
die mit der ausgetriebenen Luft entweichenden Benzindämpfe zu gewinnen, ist der
Benzinauffänger D in den Apparat eingeschaltet,
bestehend aus einem Gefaſse mit Doppelboden, in welches man kaltes oder warmes
Wasser strömen läſst. Die Benzin haltige Luft wird durch die Röhre i in den Apparat D
geleitet, welcher zu einem Theile mit solchem Fette gefüllt ist, als das zu
entfettende Material enthält. Es ergibt sich ein Benzinfett, welches bei der
folgenden Behandlung in A mit eingeführt wird.
Tafeln