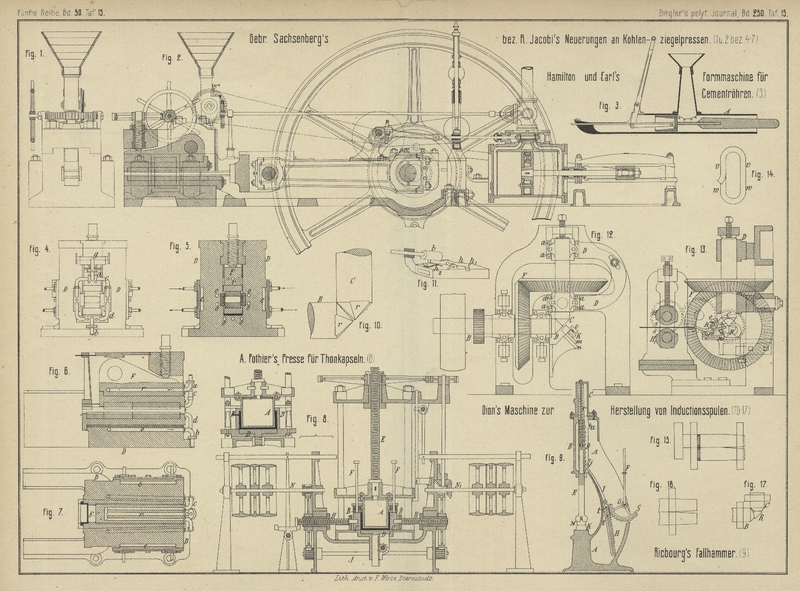| Titel: | E. Ricbourg's Fallhammer. |
| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 201 |
| Download: | XML |
E. Ricbourg's Fallhammer.
Mit Abbildung auf Tafel 15.
[Ricbourg's Fallhammer.]
Einen Fallhammer mit eigenthümlichem, einfachem Handbetriebe schlägt E. Ricbourg in Paris (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 23711 vom
15. Februar 1883) in der durch Fig. 9 Taf.
15 dargestellten Ausführung vor.
Der eigentliche Hammer M sitzt am Ende der Stange E, welche sich in dem cylinderförmigen Ansätze BC des Gestelles A auf-
und abbewegen läſst. Oben ist die Stange E an ihrem
hinteren Ende mit der verzahnten Rippe D versehen,
welche in einer entsprechenden Führung in der hinteren Wand des Cylinders BC gleitet, so daſs sich der Hammer M bezieh. die Stange E
während der Arbeit nicht drehen kann. In diese Zahnstange D greift die in dem Gestelle A geführte
Stange I mit ihrem Zahne i
ein. Dieselbe kann mittels der gelenkig mit ihr verbundenen Zahnstange H und des auf die Querwelle G mit dem Hebel F aufgekeilten Zahnbogens S auf- und niedergelassen werden. Die Stange H gleitet mit einem in ihr angebrachten Längsschlitze
auf den beiden Führungsbolzen t, welche im Gestelle A befestigt sind. Durch Auf- und Abbewegen des Hebels
F läſst sich der Hammer M nach Belieben mehr oder weniger hoch heben und mit mehr oder weniger
groſser Geschwindigkeit auf den Ambos K niederlassen.
Eine Feder r, welche sich mit ihrem einen Ende gegen
die Stange E und mit dem anderen gegen den Deckel des
Cylinders C stützt, vermehrt das Bestreben des Hammers,
zu fallen.
Wenn der Hammer auf seine ganze Hubhöhe gehoben wird, so stöſst der schiefe Fortsatz
j der Stange I gegen
den im Gestelle A befestigten Anschlag a und löst dadurch den Zahn i aus der Zahnstange D selbstthätig aus, so
daſs der Hammer niederfällt, ohne daſs man nöthig hat, ihm bei seinem Niedergange
mit dem Hebel F zu folgen. Man kann auch den Hebel F zweiarmig machen und seinen kürzeren Arm durch ein
Gelenk mit der Stange I direkt verbinden. Ebenso läſst
sich der Hebel F in das Gehäuse A legen, wodurch die Querwelle G wegfällt und
es möglich wird, an dem Hebel Handhaben anzubringen, um den Hammer durch zwei
Arbeiter betreiben zu lassen.
Uebrigens wird ein Arbeiter mit diesem Hammer kaum mehr leisten als mit dem
gewöhnlichen Zuschlaghammer; namentlich dürfte bei dem ziemlich groſsen Wege, der am
Hebel F zurückzulegen ist, die erreichbare Schlagzahl
eine verhältniſsmäſsig geringe sein. Der Vortheil des Hammers kann daher nur in der
Parallelführung gesucht werden.
Tafeln