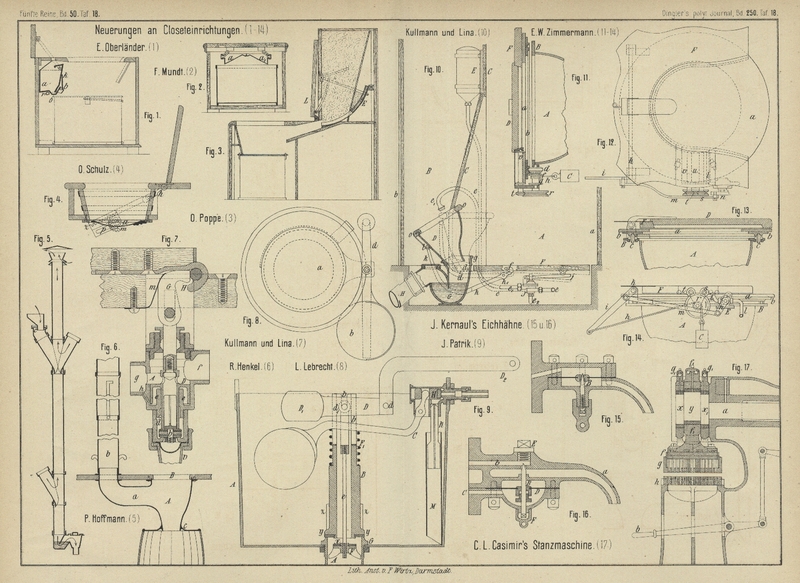| Titel: | J. Kernaul's Eichhähne. |
| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 249 |
| Download: | XML |
J. Kernaul's Eichhähne.
Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 18.
J. Kernaul's Eichhähne.
Unter Eichhähnen versteht man solche Hähne, welche innerhalb gewisser Zeiträume ganz
bestimmte Wassermengen, unter welchem Drucke auch immer das Wasser dem Hahne
zuflieſst, auslaufen lassen (vgl. Ganghofer 1882 246 * 493). Kürzlich wurden Joh.
Kernaul in München drei derartige Constructionen patentirt.
Bei der ersten Einrichtung (* D. R. P. Nr. 22980 vom 28. November 1882) ist der
Auslaufkanal a (Fig. 16
Taf. 18) des Hahnes durch eine conische Bohrung mit dem Druckwasserkanale b verbunden. In der Bohrung spielt ein conischer
Ventilstift B, welcher auf einer elastischen
Metallplatte D befestigt ist, deren untere Fläche durch
den Kanal C ebenfalls mit dem Druckwasser in Verbindung
steht. Es ist nun klar, daſs, wenn der Ventilstift auf eine bestimmte Wassermenge
eingestellt ist, eine Vermehrung des Druckes in der Wasserleitung eine Hebung des
Ventilstiftes B bezieh. eine Verengung der
Durchlauföffnung, dagegen eine Verringerung des Druckes eine Senkung bezieh. eine
Vergröſserung der Durchlauföffnung zur Folge hat, da sich die elastische
Metallplatte dem Drucke entsprechend mehr oder weniger ausbaucht. Es bleibt demnach
die Menge des durchflieſsenden Wassers stets gleich. Behufs Einstellung des
Ventilstiftes sind die Verschraubungen E und F angebracht. – Statt des Stiftes B kann man auch einen Schieber zur Regelung der Weite
der Durchgangsöffnung anwenden (vgl. * D. R. P. Nr. 22 981 vom 30. November
1882).
Am einfachsten löst die Aufgabe die dritte Einrichtung (* D. R. P. Nr. 23396 vom 20.
Januar 1883); hier ist nämlich die Durchgangsöffnung in die elastische Metallplatte
selbst verlegt, so daſs nur ein Eintritts- und ein Austrittskanal für das Wasser
angeordnet zu werden braucht. In diesem Falle steht der Ventilstift B (Fig. 15
Taf. 18) fest und kann nur zur Regelung der Durchgangsöffnung der elastischen Platte
in der Höhenrichtung verstellt werden. Der Theil dieser Platte, worin der
Ventilstift spielt, ist mit einem Wulste versehen, um eine genauere Einstellung des
Stiftes zu ermöglichen. Die Wirkung des Hahnes ist hiernach leicht ersichtlich.
Statt des conischen Ventilstiftes B, der in einer
Oeffnung der elastischen Platte spielt, kann man auch ein dachförmiges Ventil
nehmen, welches sich auf den oberen äuſseren Rand des Wulstes der elastischen Platte
legt.
Um eine Verstopfung der Durchgangsöffnung der elastischen Platte möglichst zu
verhindern, ordnet Kernaul auf der Druckseite dieser
Platte im Gehäuse eine
schräge Rippe an, durch welche das Wasser verhindert wird, direkt auf die
Durchgangsöffnung der Platte zu treffen, vielmehr Wirbel erzeugt, welche eine
Ablagerung der Unreinigkeiten in der durch die Rippe gebildeten Ecke
begünstigen.
Tafeln