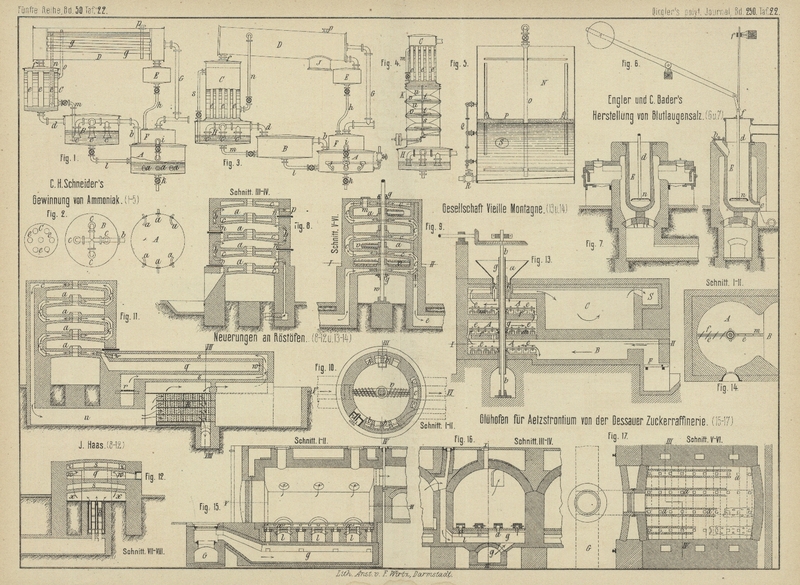| Titel: | Neuerungen an Röstöfen. |
| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 314 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Röstöfen.
Patentklasse 40. Mit Abbildungen auf Tafel 22.
Neuerungen an Röstöfen.
Der Röstofen von J. Haas in Stolberg bei Aachen (* D. R.
P. Nr. 23080 vom 15. August 1882) besteht, wie Fig. 8 bis
10 Taf. 22 zeigen, aus vier über einander liegenden Muffeln a, welche unter sich durch die Kanäle b verbunden sind, während die Heizgase durch die Züge
c hindurchgehen, um bei e zu einem Vorwärmer zu gehen. Die in diesem erwärmte Luft tritt bei f in die unterste Muffel. Auf der durch Sandverschluſs
g abgedichteten senkrechten Welle w, welche in passender Weise gedreht wird, sind für
jede Sohle guſseiserne Doppelarme v mit eingesetzten
Schaufeln befestigt. Die Schaufeln der einen Seite des Doppelarmes stehen fest; die
des anderen können mittels Hebels und verschiebbaren Anschlages z so umgestellt werden, daſs dieselben das bei m eingebrachte Röstgut nach der Mitte oder nach dem
Umfange der Sohle schieben. Ist das Röstgut auf der oberen Sohle entsprechend
abgeröstet, so werden die beweglichen Schaufeln so gestellt, daſs das Erz nach dem
Umfange geschoben wird und durch die mit einem Steinschieber versehene Oeffnung n zur nächst tieferen Sohle gelangt, bis es auf der
unteren Sohle todtgeröstet durch die Oeffnung o nach
auſsen geschoben wird. Die Röstgase werden durch Kanäle b von Sohle zu Sohle geführt und ziehen bei p
zur weiteren Verwerthung ab.
Bei dem in Fig. 11 und
12 Taf. 22 dargestellten Ofen schlieſst sich an die unterste kreisrunde
Sohle noch eine rechteckige, geschlossene, zum Todtrösten bestimmte Sohle q an. Dieser Ofen hat eine besondere Feuerung r, kann aber auch, wie der vorige, eine Zuführung von
Heizgasen erhalten, welche von einem auſserhalb liegenden Generator entnommen
werden. Die Feuergase umziehen die Muffel durch die Hohlräume s und gelangen bei z in
die Räume c der runden Muffeln. Haben sie diese
verlassen, so treten sie durch den Kanal u in den
Regenerator R und wärmen die zur Oxydation nöthige Luft
vor. Diese tritt bei w durch die Kanäle x in die Todtröstmuffel. Die erzeugten Röstgase gehen
von dieser Sohle in die runden Muffeln a und
durchziehen dieselben in der vorhin angegebenen Weise.
Der von der Gesellschaft Vieille Montagne in Chenée bei
Lüttich (* D. R. P. Nr. 24155 vom 16. Januar 1883) namentlich für Blende bestimmte Röstofen mit
Rührwerk besteht aus mehreren über einander liegenden Röstsohlen A (Fig. 13 und
14 Taf. 22), an welche sich eine viereckige Röstfläche B anschlieſst. Am Ende derselben befindet sich die
eigentliche Feuerung F. Für Schwefelkies und andere
leicht zu röstende Erze genügen die über einander liegenden Röstsohlen, auf welchen
man ohne weitere Verwendung von Brennstoffen die Röstung vornehmen kann.
Das in den Trichter a geschüttete zerkleinerte Erz wird
mittels zweier Walzen nach und nach durch Kanäle k auf
die oberste Röstsohle geschafft, um mittels der sich drehenden Schürhaken auf die
darunter liegenden Röstflächen befördert zu werden. Die Feuergase bestreichen den
Herd B, dann die einzelnen Röstsohlen A und entweichen durch die Staubkammer C in den Abzugskanal S.
Die Schürvorrichtung besteht aus einer senkrecht durch den Ofen gehenden Achse b, deren Querstangen e die
Schüreisen tragen.
Der Abschluſs zwischen der Achse und dem Ofen geschieht mittels Asbestpackung. Die
Achse b befindet sich in einer eisernen Hülse g, an welcher sie an verschiedenen Stellen befestigt
ist. In dem Zwischenräume zwischen g und b steigt von unten Kühlluft empor und verhindert
dadurch ein zu schnelles Zerstören der Hülse g. Die
gezahnten Schüreisen m sind in der radialen Richtung an
den Armen e befestigt und dienen lediglich zum
Durchrühren des Erzes. Die glatten Schürhaken f dagegen
sind schräg zur radialen Richtung des Armes e
eingesetzt und bewirken den Transport des umgerührten Erzes je nach ihrer
Winkelstellung entweder von der Mitte nach dem Umfange oder von hier nach der Mitte
der runden Röstsohlen. Durch eine in der Mitte oder an dem Umfange entsprechend der
Winkelstellung der Schürhaken f angebrachte Oeffnung in
der Röstsohle fällt das durch einander gerührte Erz auf die darunter liegende
Röstsohle, wird hier abermals durch die Schüreisen m
umgerührt und durch die Schürhaken f wieder nach der
Oeffnung zur nächstliegenden Röstsohle befördert, schlieſslich zur Todtröstung auf
den Herd B.
Tafeln