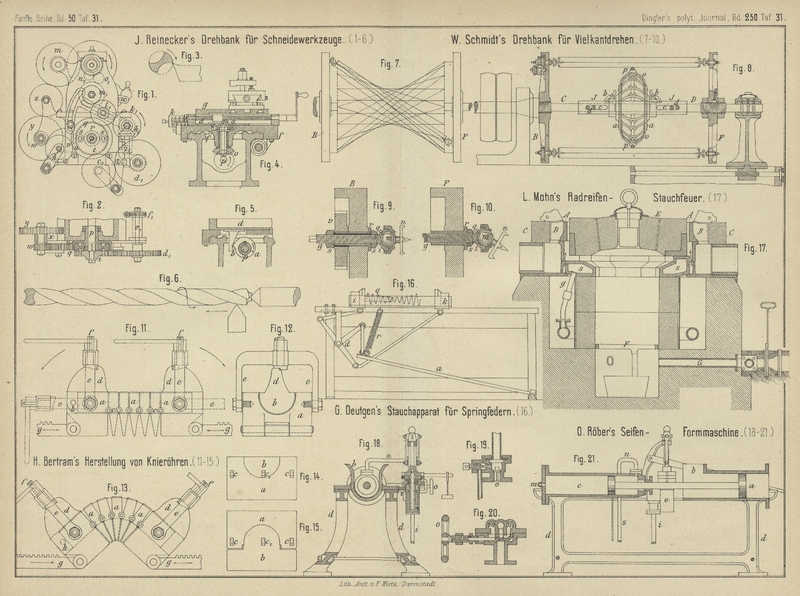| Titel: | W. H. A. Schmidt's Drehbank zum Vielkantdrehen. |
| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 446 |
| Download: | XML |
W. H. A. Schmidt's Drehbank zum
Vielkantdrehen.
Mit Abbildungen auf Tafel 31.
W. Schmidt's Drehbank zum Vielkantdrehen.
Um steigende, fallende und gerade Profile auf mehrkantigen Stäben erzeugen zu können,
gibt W. H. A. Schmidt in Berlin (* D. R. P. Kl. 38 Nr.
22155 vom 13. Oktober 1882) die in Fig. 7 bis
10 Taf. 31 dargestellte Anordnung an.
Die Stäbe werden je nach der Steigung der herzustellenden Profile schräg zwischen
zwei Planscheiben B und F
eingespannt und dieselben immer nur auf geringe Länge in beständiger Folge bearbeit.
Da nämlich die Werkstücke nicht parallel, sondern unter einem Winkel zur Drehachse
eingespannt sind, so würden dieselben auch eine verwundene Form erhalten, wenn man
sie ohne Unterbrechung in ihrer ganzen Länge bearbeiten wollte. Man dreht daher auch
immer nur ein so kurzes Stück ab, daſs die Windschiefe des Profiles noch unmerklich
ist, und dreht die Werkstücke alsdann entsprechend um ihre eigene Achse, wobei ein
auf das Bett der
Maschine aufgesetzter Anschlag als Lehre dient. Dieses Drehen erfolgt bei allen
Stücken gleichzeitig, da die Klauen, welche dieselben halten, durch Zahnräder
gekuppelt sind. Die Art der Bearbeitung der Stäbe unterscheidet sich auſserdem nicht
von dem bei diesen Maschinen auch sonst angewendeten Verfahren (vgl. Weisse 1880 237 * 357. Bahn 1881 242 451. Wenzel bezieh. Hoff 1882
245 * 56).
Die beiderseitige Einspannung der Stäbe in die Planscheiben B und F erfolgt mittels der in Fig.
9 und 10
dargestellten Klauen n, welche durch ihre gelenkige
Lagerung mittels der Kugeln m in den Kugelschalenlagern
i beliebig verdrehbar sind. Die Kugelschale i ist mittels ihres mit Gewinde versehenen Zapfens g verschiebbar in der Hülse r derart, daſs durch die Muttern s ein
Heraus- und Hereinziehen der Kugelschale i erfolgen
kann. Auf diese Weise werden geringe Unterschiede in der Länge der Stäbe
ausgeglichen. Unter Vermittelung des aufgekeilten Zahnrädchens v erhält dann die Büchse r
und damit auch das Werkstück die oben erwähnte absatzweise Drehung entsprechend dem
Vor. schreiten der Arbeit.
Damit aber die Vollkugel m bei dieser Drehung
mitgenommen werde, ohne ihre Winkelbewegung einzubüſsen, ist in dieselbe eine Nuth
eingefräst, in welche eine Schraube q eingreift. Diese
kuppelt die Theile i und m
in der gewünschten Weise. Um die gröſstmögliche Sicherheit gegen eine
unbeabsichtigte Verdrehung der Räder w gegen einander
während der Bearbeitung der Stäbe zu erhalten, ist um sämmtliche Räder v ein Bremsband geschlungen, welches an den
Berührungsstellen mit diesen Rädern mit je einem Bremsklotze versehen ist.
Um die Schrägstellung der Stäbe zwischen den Planscheiben zu ermöglichen, müssen
letztere sich gegen einander verdrehen lassen. Dies wird erreicht durch die mittels
Schraubengewinde erfolgte Verbindung der Planscheiben mit ihren Wellen. Beide
Scheiben B und F sitzen
auf besonders gelagerten Wellen C und D (vgl. Fig. 8),
welche durch eine aufgeschobene Röhre J mit einander
verbunden sind. Die Verschiebung beider Planscheiben gegen einander ist einmal des
Gewindes wegen zulässig, dann aber besonders wegen der Schlitze c in der hohlen Verbindungswelle J, in welchen sich die Wellen C und D mittels der Gleitstücke d führen und verschieben lassen. Für den Fall, als ein
genügend langes Gewinde für eine der Scheiben auf der Welle vorgesehen würde, könnte
diese auch voll durchgehen und die Zusammensetzung mittels der Hülse J fortfallen.
Zur gehörigen Unterstützung längerer Stäbe ist zwischen den Planscheiben eine
Vorrichtung angebracht, welche den Stäben eine sichere elastische Auflage gibt;
dieselbe besteht aus zwei Scheiben a, welche durch
federnde Bügel o mit einander verbunden sind; am
Umfange liegt ein Gummiring p. Die Veränderung des
Durchmessers der Scheibe entsprechend der gröſseren oder geringeren Stärke bezieh.
Schrägstellung der
eingespannten Stäbe wird durch die Verstellung der Scheiben a auf der Welle J mittels der dargestellten
Klinken b bewirkt. Die Elasticität der Bügel o hält die Klinken b in
der Verzahnung der Welle J.
Es wird vom Erfinder hervorgehoben, daſs mittels dieser Drehbank jedes beliebige
Material in der angedeuteten Weise bearbeitet werden kann.
Tafeln