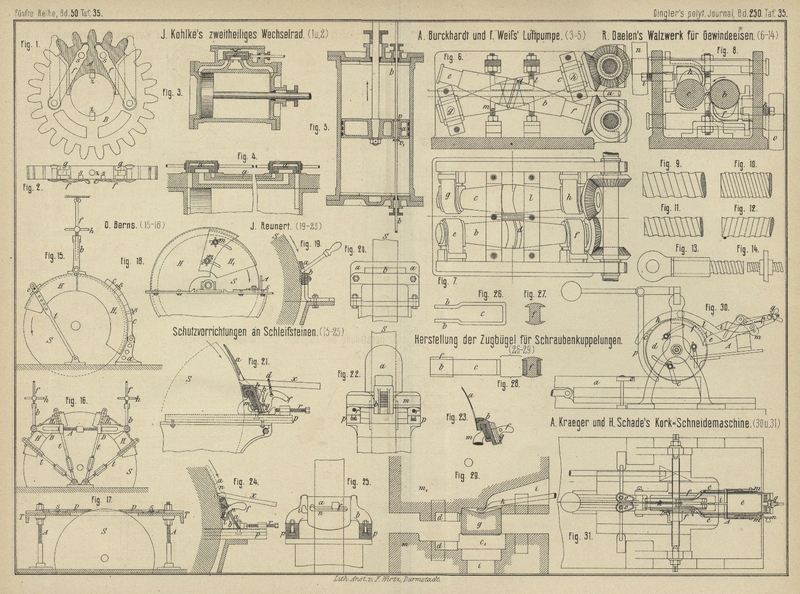| Titel: | Kork-Zerschneid- und Beschneidmaschine. |
| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 502 |
| Download: | XML |
Kork-Zerschneid- und
Beschneidmaschine.
Mit Abbildungen auf Tafel 35.
Kraeger und Schade's Kork-Zerschneide- und
Beschneidemaschine.
Sind cylindrische Korke in gröſseren als der verlangten Länge hergestellt, so werden
sie in einzelne Stücke zertheilt; in gleicher Weise müssen solche Korke, welche
durch die Klemmköpfe während ihrer Bearbeitung an den Enden beschädigt sind,
abgeschnitten werden, um saubere Stirnflächen zu erhalten. Zu dieser Arbeit scheint
die an A. Kraeger und H. Schade in Dresden (* D. R. P.
Kl. 38 Nr. 21852 vom 12. September 1882) patentirte Maschine bestimmt zu sein.
Aus dem Zuführungskanale A (Fig. 30 und
31 Taf. 35) gelangen die Korkstücke auf die mit der Scheibe d verbundenen Greifer c,
welche dieselben durch die Führungen l, k und p führen und dem durch Kurbel und Schubstange hin- und
hergeschobenen Messer a darbieten. Um Korke von
verschiedener Länge den Greifern stets in der richtigen Lage zuführen zu können, ist
die Weite des Kanales A veränderlich, indem sich die in
der Rinne e liegenden Backen f mittels einer Schraube g gleichmäſsig nach
der Mitte zu zusammenrücken oder entfernen lassen. Die Höhe des Kanales A begrenzt ein ebenfalls einstellbarer Finger i, welcher immer nur einen Kork unter sich
hinwegschlüpfen läſst. Die Stellung dieses Fingers ist abhängig gemacht von der
Stellung des Führungsstückes k, welches den von einem
Greifer c aus dem Kanäle A
aufgenommenen Kork auf dem Umfange der Scheibe d hält.
Der Halter k sitzt beweglich an den Enden eines
zweitheiligen Winkelhebels l, dessen Zapfen in je einem
Schlitzloche der Rinne e stecken. Die beiden Enden von
l sind mit zwei gleichfalls zu beiden Seiten der
Rinne e liegenden und unterhalb derselben durch eine
Achse verbundenen Hebeln m gekuppelt. Mittels der
Zugstange n erfolgt dann die Stellung von m und damit auch die von l,
k und i.
Die Greifer c sitzen mit Zapfen in den geschlitzten
Endscheiben der Walze d, so daſs sie durch deren
Verdrehung eingezogen oder herausgeschoben werden können, wie dies die Dicke des zu
zertheilenden Korkes verlangt. Die Scheibe d erhält
ihre Bewegung von der das Messer a hin- und
herschiebenden Kurbelwelle. Um einen leichten Schnitt des Messers herbeizuführen,
wird demselben stetig eine geringe Menge Fett zugeleitet. Zu diesem Zwecke sind zu
beiden Seiten des Messers kleine Oelbehälter o
angeordnet, welche seitlich durchlöchert, aber mit Filz überzogen sind, so daſs sich
durch letzteren hindurch das Oel dem Messer a
mittheilen kann.
Tafeln