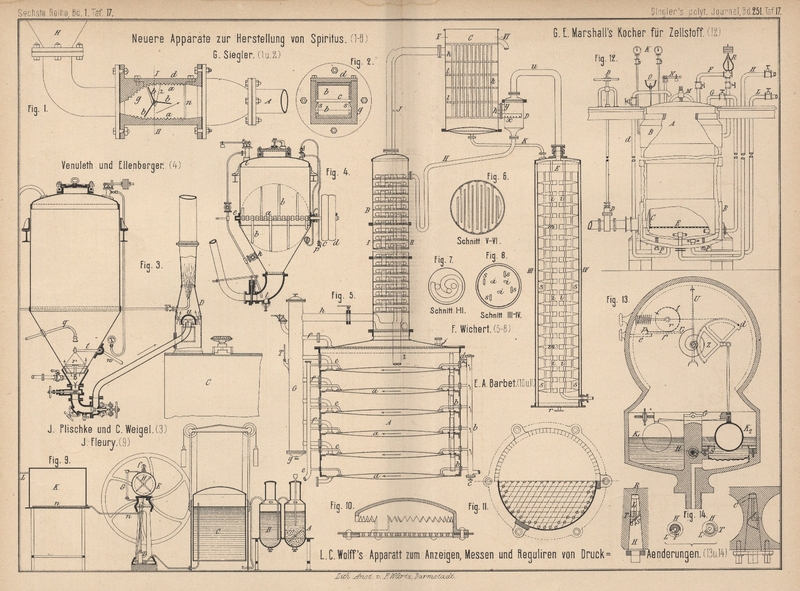| Titel: | Neuere Apparate zur Herstellung von Spiritus. |
| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 221 |
| Download: | XML |
Neuere Apparate zur Herstellung von
Spiritus.
Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 17.
(Fortsetzung des Berichtes Bd. 247 S.
372.)
Neuere Apparate zur Herstellung von Spiritus.
Der Zerkleinerungsapparat für gedämpfte Körner von G.
Siegler in Hohenjesar (* D. R. P. Nr. 22855 vom 17. November 1882) besteht, wie Fig.
1 und 2 Taf. 17
zeigen, im Wesentlichen aus einem guſseisernen Gehäuse g mit leicht abnehmbarem Deckel d, welche
beide mit Rippen a versehen sind. Rechtwinklig zur
Zuströmungsöffnung befindet sich im Gehäuse g, auf
angegossenen Stützen s ruhend, eine leicht drehbare
Welle c, an welcher 3 Flügel b befestigt sind. Am Deckel d ist ein
Rostgitter n und das Lappenpaar z angegossen, welches letztere zur Lagerung der Welle c dient.
Dieser Apparat wird zwischen den Henze'schen Dämpfer
H und den Vormaischbottich in das Ausblaserohr A eingeschaltet.
Strömt nun aus dem Dämpfer nach Oeffnung des betreffenden Ventiles der gedämpfte
Roggen heraus, so wird die Welle c durch den Druck der
Masse auf die Flügel b in Bewegung gesetzt. Durch die
Drehung der Flügel b wird nun die Masse gegen die
Rippen a und die Kanten des Gitters n geschleudert und geht zerkleinert in den
Vormaischbottich. Der mit Schrauben auf dem Gehäuse befestigte Deckel gestattet,
Flügel mit Welle für das Kartoffelmaischen leicht herauszunehmen, sowie den Apparat
zu reinigen.
Dem Dämpfer werden 90 bis 100l Wasser für je 50k Roggen, Weizen oder Gerste zugeführt. Darauf
wird der Dampf eingelassen, welcher nach 10 Minuten einen Druck von 1 bis 1at,5 im Dämpfer erzeugt. Nun öffnet man das
Ablaſsventil oben am Dämpfer ein wenig und läſst die kalte Luft zugleich mit etwas
Dampf entströmen und den Inhalt unter 3at Druck
etwa 1 bis 1 ½ Stunden kochen. Darauf wird die Masse in 10 bis 15 Minuten
ausgeblasen, wobei der Apparat in angegebener Weise und in jeder Beziehung
zufriedenstellend arbeiten soll.
J. Plischke in Krappitz und C. Weigel
in Neiſse (* D. R. P. Zusatz Nr. 23634
vom 6. December 1882) bringen zur Auflösung der
Stärke im Dämpfer in der Spitze desselben einen kleinen Kegel r (Fig. 3 Taf.
17) an, welcher durch eine Stange in einem Querstege geführt wird, während er an
einem Hebel t hängt, dessen Achse durch eine
Stopfbüchse nach auſsen geht und dort mit dem Handhebel w versehen ist. Dieser Kegel vertheilt die aufzuschlieſsende
Kartoffelmasse besser, so daſs die Einwirkung des durch Rohr q einzutreibenden heiſsen Wassers besser ist als sonst.
Ueber dem Vormaischbottiche C ist ein Gebläse D angebracht, in welchem die aufgelöste Kartoffel-
bezieh. Fruchtmasse in der Richtung nach oben getrieben wird, wo sie auf eine
Glocken trifft und durch diese vertheilt und nach unten abgelenkt wird, so daſs der
aufsteigende Luftstrom, welcher durch einen in D
wirkenden Dampfstrahl erzeugt wird, die Masse an möglichst vielen Punkten berührt
und demgemäſs kräftig kühlt.
Venuleth und Ellenberger in Darmstadt (* D. R. P. Nr. 23126 vom 12.
December 1882) empfehlen einen Dämpfer mit
horizontalem Rührwerke zur Verarbeitung von Mais, Roggen u. dgl. In den
Stopfbüchsen e und f (Fig.
4 Taf. 17) ist eine mit Rührer b versehene
Welle a mit Leerund Vollscheibe c und d gelagert. Durch diese Vorrichtung
werden die zu dämpfenden Körner in eine starke Bewegung von oben nach unten
gebracht. Uebrigens ist der Dämpfer wie gewöhnlich mit Dampfeinströmungsöffnungen
i, k und l, sowie mit
Lufthahn p versehen.
F.
Wichert in Berlin (* D. R. P. Nr. 21741 vom 27. Juli
1882) will zur Gewinnung von Feinsprit ohne Filtration den
Spiritus schon bei 61° abdestilliren, während sich die Fuselöle erst bei 65°
verflüchtigen sollen. Zu diesem Zwecke ist die Blase A
(Fig. 5 bis 8 Taf. 17)
durch doppelte Böden a in kleinere Abtheilungen und
dadurch der flüssige Inhalt der Blase in entsprechend kleinere Theile zerlegt, deren
jeder gleichzeitig mit einer geheizten Bodenfläche in Berührung steht. Die geringe
Flüssigkeitsmenge in den einzelnen Blasenabtheilungen erwärmt sich durch die
vorhandene groſse Bodenheizfläche sehr schnell und gleichmäſsig und es genügt daher
zur Heizung sehr niedrig gespannter Dampf. Derselbe soll die Blasenabtheilungen
schon bei einer Temperatur von 61° abtreiben und sollen daher die Fuselöle nicht mit
verdampfen können. Jeder Doppelboden steht durch ein Dampfrohr b mit der Hauptdampfleitimg in Verbindung, welche
ihrerseits bei c ein Absperrventil besitzt. Das kleine
Ventil d dient zum Abhalten des Dampfes aus dem
Doppelboden der obersten Abtheilung, bis sich in derselben der aus der Colonne B kommende Lütter angesammelt hat. Der Dampfeinströmung
gegenüber befindet sich bei den Böden a der Abfluſs e für das Condensationswasser.
Die Spritdämpfe verlassen die Blasenabtheilungen durch die Rohre f und gelangen in das gemeinschaftliche Rohr G, von wo sie das Rohr h
zur Colonne B führt. Das Rohr G besitzt bei g einen Abfluſsstutzen, bei T ein Thermometer, nach dessen Stand die Dampfzuleitung
regulirt wird, ein Luftventil und oben einen Stutzen, an welchem sich eine
Drosselklappe befindet, um das Phlegma getrennt abtreiben zu können. Die Spritdämpfe
treten durch das Schlangenrohr h ein und durchziehen
die Colonne von unten nach oben, indem sie unter Dephlegmation ihren Lutter
absetzen, welcher, von Abtheilung zu Abtheilung fallend, schlieſslich durch das Rohr
z in den Lutterkasten flieſst.
Von der Colonne B leitet das Rohr J die Dämpfe in den Condensator C. Derselbe besteht aus doppelten Wänden k,
welche durch Böden l in beliebige Theile zerlegt
werden. Die Spritdämpfe ziehen zwischen den Wänden schlangenartig von oben nach
unten durch die versetzten Oeffnungen in den Böden l
und schlieſslich durch Rohr y in den Sammeltopf D, während das Dephlegma durch Rohr x austritt und durch Rohr H zur Colonne zurückgeführt wird. Durch das Geistrohr u gelangen die Spritdämpfe dann nach vollendeter
Dephlegmation in den Kühler E. Dieser besteht aus einem
Doppelmantel, dessen innerer Mantel eine beliebige Anzahl linsenförmiger Doppelböden
m umschlieſst, welche je drei runde, durch die
Böden gehende Rohre i besitzen. Die linsenförmigen
Böden m sind unter einander durch flach gedrückte Rohre
s verbunden, durch welche der sich verflüchtigende
Sprit von Abtheilung zu Abtheilung flieſst.
Das benutzte Kühlwasser gelangt durch das Rohr K zum
Condensator und läuft bei r frei ab. Behufs
Inbetriebsetzung wird der Apparat durch Ansatz j
gefüllt, indem der zu entfuselnde Spiritus noch mit etwa 40 bis 45 Proc., Wasser versetzt
wird, die Dampfzuleitung geöffnet und unter Beobachtung des Thermometers genau
regulirt.
E. A.
Barbet in La Madeleine-les-Lille (*
D. R. P. Nr. 22617 vom 17. Oktober 1882) empfiehlt
für Destillir- und Rectificirapparate eine Vereinigung von
Lochplatten und Kappen. Die gebräuchlichen Kappenapparate sind gewöhnlich
leicht zu betreiben und geben sehr feine Alkohole; sie sind aber von begrenzter
Leistungsfähigkeit und bei gewissen teigartigen Producten verursacht das
Verschmutzen der Kappen Arbeitsunterbrechungen für eine oft mühsame Reinigung. Der
vorliegende Lochplattenapparat zeichnet sich dagegen durch hohe
Erschöpfungsfähigkeit aus. Die Flüssigkeit wird durch die Heftigkeit des Gasstrahles
gewissermaſsen pulverisirt und dies erleichtert die Austreibung der flüchtigsten
Antheile aus derselben. Kein System ist jedoch auch günstiger für das
Blasenfortreiſsen, was der Feinheit der Alkohole schadet. Die durchlochten Platten
sind für Destillirsäulen versucht worden und haben bei der Ingangsetzung
ausgezeichnete Resultate gegeben. Sobald aber Weinsäure die Plattenlöcher
vergröſsert hatte, war die Wirkung des Apparates gestört und man muſste nach kurzer
Zeit auf die Anwendung der Platten verzichten.
Anstatt die Löcher gleichmäſsig auf der ganzen Fläche der Platte zu vertheilen,
vereinigt sie Barbet, wie aus Fig. 10 und
11 Taf. 17 zu ersehen ist, zu einer gewissen Anzahl isolirter Gruppen,
deren Bohrung gedrängter ist; diese Gruppen sind derartig auf der Oberfläche
vertheilt, daſs die absteigende Flüssigkeit der darüber liegenden Platte gezwungen
ist, sich der vielfachen Wirkung des Dampfstrahles zu unterziehen, bevor sie zum
nächsten Abfluſsrohre gelangt, d.h. man muſs diese Gruppen von Dampfstrahlen so
anordnen, wie man gewöhnlich die Kappen vertheilt. Auſserdem bedeckt man jede Gruppe
von Dampfstrahlen mit einer Kappe aus Bronze oder anderem Metall. Die auf die Platte
genieteten oder geschraubten Lappen sichern die Stellung der Kappe. Der Abstand der
Zähne von der Platte ist so berechnet, daſs die Flüssigkeit frei unter der Kappe
kreisen und sich erneuern kann. Die Dampfstrahlen pulverisiren die Flüssigkeit und
das Gemisch von Dampf und Flüssigkeit zermalmt sich auf dem Kappenmetalle, was die
innige Annäherung der Mischung vervollständigt und den Wechsel der flüchtigen
Substanzen erleichert.
J.
Fleury in Rennes (* D. R. P. Nr. 24204 vom 6. Oktober
1882) will sein Verfahren der Abscheidung des
Alkoholes aus Maische mittels Kohlensäure auf Weinhefe, Runkelrüben,
Melasse u. dgl. anwenden. Zu diesem Zwecke wird in einem Gefäſse A (Fig. 9 Taf.
17) Kohlensäure auf bekannte Weise durch Einwirkung von Salzsäure auf Kalkstein
hergestellt. Hiernach gelangt die Kohlensäure mittels Rohrleitung in den
Waschapparat B und von diesem in den Gasometer C. Die Pumpe D saugt die
Kohlensäure aus dem Gasometer C; zugleich zieht sie die
Alkoholmaische aus einem
entsprechenden Behälter herbei; beide werden dann zusammen von der Pumpe D in den mit Manometer f,
Rührer H und Standglas G
versehenen Sättiger E gepreſst, wo sich die Kohlensäure
mit der Alkoholmaische unter einem Drucke von 15at
verbindet.
Wenn die Alkoholmaische mit Kohlensäure gesättigt ist, so gelangt das Gemisch durch
das vorn siebförmig durchlöcherte Rohr n in den
Verdampfungsapparat K. Wenn der Verdampfungsapparat
gefüllt ist, wird die Zuleitung abgeschlossen und der erstere durch die Röhre L mit dem Rectificator in Verbindung gesetzt. Die
festen Bestandtheile der Maische sollen sich auf dem Boden des Verdampfungsapparates
ausbreiten, während die flüchtige Kohlensäure alle Alkoholdämpfe, sowie alle anderen
vorhandenen Dämpfe mit sich fortreiſsen und in den mit dem Verdampfungsapparate in
Verbindung stehenden Rectificator leiten soll, aus welchem dann angeblich ein
vollkommen reiner und geruchloser Alkohol erhalten wird.
Tafeln