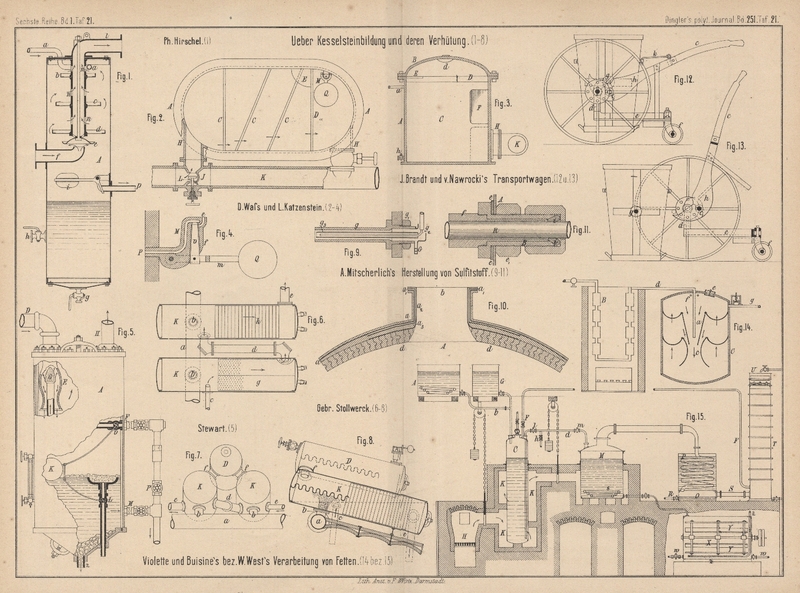| Titel: | Ueber die Gewinnung und Verarbeitung von Fetten. |
| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 270 |
| Download: | XML |
Ueber die Gewinnung und Verarbeitung von
Fetten.
Patentklasse 23. Mit Abbildungen auf Tafel 21.
Ueber die Gewinnung und Verarbeitung von Fetten.
Ch.
Violette und A. Buisine in
Lille (* D.
R. P. Nr. 23777 vom 7. Oktober 1882) wollen zur vollständigen Gewinnung der in Fetten vorhandenen wesentlichen
Bestandtheile: Talg, Oel, Schmalz u. dgl., unter Druck mit wässeriger
Ammoniakflüssigkeit behandeln, das dadurch gebildete Gemisch von Glycerin und
Ammoniumseife zur Wiedergewinnung des Ammoniaks erhitzen, so daſs freie Fettsäuren
und Glycerin erhalten werden.
Zu diesem Zwecke wird das Fett in einem Behälter A (Fig.
15 Taf. 21) geschmolzen, durch Rohr b in den
innen emaillirten oder verzinnten Kessel C abgelassen,
während man gleichzeitig aus dem Behälter G so viel
Ammoniakflüssigkeit eintreten läſst, daſs auf 100 Th. Fett etwa 5k Ammoniak kommen. Der mit Manometer,
Sicherheitsventil und
Probehahn versehene Kessel wird entweder durch in einen doppelten Mantel
eingeleiteten Dampf oder durch die Flamme eines Herdes H erhitzt, welche in 3 Kanälen K um den
Apparat herum geführt werden. Man steigert die Temperatur allmählich derart, daſs
der Druck während einiger Stunden zwischen 5 und 7at schwankt.
Ist die Verseifung beendet, so werden bei geschlossenem Hahn h die Hähne l und m geöffnet, so daſs der im Autoclaven herrschende Druck die flüssige Masse
durch das Rohr d in den Kessel M treibt. Dieser steht durch Helm und Rohr mit einer Schlange P und der Condensationscolonne T in Verbindung. Die Zersetzung der Ammoniakseife beginnt mit dem
Eintritte derselben in den Kessel M; sie wird
vervollständigt durch Erhitzung der Masse mittels Dampfschlange s, indem man die Temperatur allmählich bis auf 180°
erhöht und ein wenig Luft einbläst. In einigen Stunden ist die Zersetzung beendet.
Der gleichzeitig mit dem Ammoniak frei werdende Wasserdampf condensirt in der
Schlange P und das Ammoniakwasser flieſst aus dem
Behälter O durch den Hahn R in ein geeignetes Gefäſs. Dieses Ammoniakwasser wird bei den folgenden
Operationen wieder benutzt. Das nicht condensirte Ammoniakgas gelangt durch ein Rohr
S in die Colonne T, wo
es durch Wasser, welches cascadenartig vom oberen Theile U der Colonne herabfällt, völlig niedergeschlagen wird. Die Ammoniaklösung
wird im unteren Theile des Apparates gesammelt, um bei späteren Operationen
verwendet zu werden. Während dieser Zeit wird Kessel C
von neuem beschickt, nachdem er hinreichend abgekühlt ist. Um während der
Beschickung Ammoniakverluste zu vermeiden, wird das Rohr F mit dem unteren Theile der Colonne T
verbunden.
Das aus Glycerin und völlig reinen unveränderten Fettsäuren bestehende Gemisch wird
aus dem Kessel M in dem Behälter X gelassen, dessen Wasserfüllung durch das gelochte
Dampfrohr z erwärmt wird. Nach guter Durchmischung
mittels eines Rührwerkes Y wird die Wasser haltige
Flüssigkeit durch einen Hahn w abgelassen; nach
mehreren Waschungen läſst man die völlig von Glycerin befreiten Fettsäuren durch den
anderen Hahn nach einem besonderen Behälter flieſsen. Die passend abgekühlten
Fettsäuren werden einer Pressung ausgesetzt und in feste Fettsäuren, welche nach
Filtrirung oder Destillation, wenn dies erforderlich sein sollte, für die
Kerzenfabrikation geeignet sind, und in Oelsäure zerlegt, welche keine
Zersetzungsproducte enthält und für die industrielle Verwerthung dieser Fettsäuren
geeignet ist. Die Glycerin enthaltende wässerige Flüssigkeit wird in passender Weise
verarbeitet.
Ch. F. E.
Poullain und E. F. Michaud in
Paris (D. R.
P. Nr. 23213 vom 2. November 1882) schlagen die Verwendung von Zinkoxyd oder Zinkstaub bei der Verseifung der Fette vor.
Die Fette sollen in einem Autoclaven unter einem Drucke von 8 bis 9at mit 25 Proc. Wasser und 0,2 bis 0,6 Proc.
Zinkoxyd oder Zinkstaub 3 bis 4 Stunden lang erhitzt werden. Die Gewinnung von
Glycerin und Fettsäuren aus der erhaltenen Masse soll in derselben Weise geschehen
wie bei der Kalkverseifung.
Der in Fig. 14 Taf. 21 dargestellte Apparat zur
Gewinnung vollkommen neutraler Seife von W. West in
Denver, Colorado (* D. R. P. Nr.
24614 vom 21. November 1882), besteht im Wesentlichen aus einem auf hohen
DruckIn der Patentschrift steht: „die einem Drucke von 250 engl. Pfund (125k) pro Quadratcentimeter widerstehen
kann“; dies soll doch wohl heiſsen 17k,5 auf 1qc?Ref. geprüften Kessel C, in welchen, durch den Apparat B überhitzter Wasserdampf eingeführt wird. Das
Dampfrohr d ragt in einen Kegel a, unter welchem ein Doppelkegel c befestigt
ist. Man füllt in den Kessel durch Mannloch e oder bei
f eintretende Röhren Fett und Alkalilaugen und
laſst auf 225° überhitzten Dampf in den Kessel treten, welcher das Fettgemisch in
der Richtung der Pfeile in Bewegung setzt. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die
Verseifung beendigt ist. Das hierbei durch Rohr g
überdestillirende Glycerin u. dgl. wird in gekühlten Vorlagen gesammelt.
Zur Gewinnung von Fett aus den Rückständen der
Lederleimfabrikation empfiehlt J. A. L. Leblanc in
Lyon (D. R.
P. Nr. 23779 vom 28. Oktober 1882) die Erwärmung derselben mit verdünnter
Schwefelsäure. Nach seinen Versuchen enthalten die Abfälle, welche bei dem
Ausfleischen der in den Gerbereien verarbeiteten Häute erhalten werden, nachdem der
Leim daraus gewonnen ist, noch Fette, welche theils an Kalk gebunden sind, welchen
man in der Lohgerberei verwendet, theils durch leimartige Stoffe umhüllt werden. Zur
Gewinnung dieser Fette werden die Abfälle in Behälter gebracht, welche durch eine
Heizschlange o. dgl. erhitzt werden. Auf 100k
Abfälle bringt man dann 50l Wasser, welches mit
Schwefelsäure so weit angesäuert ist, daſs es etwa 5 bis 6° B. hat. Dann läſst man
das Ganze kochen und gieſst nach und nach Schwefelsäure von 48° B. zu, bis eine
vollständige Sättigung eingetreten oder bis das Fett obenauf schwimmt und kein
Aufbrausen mehr stattfindet. Diese Behandlung dauert etwa 2 bis 3 Stunden. Man
schlägt alsdann in Mengen von 15 bis 20k die Masse
in Tücher ein und bringt sie unter eine hydraulische Presse, wobei eine jede
Tuchfüllung von der anderen durch eine Platte getrennt wird. Die beim Auspressen
ablaufende Flüssigkeit wird in Behälter eingebracht und das obenauf schwimmende Fett
abgeschöpft. Die in den Tüchern verbleibenden Preſskuchen bestehen aus an Stickstoff
sehr reichen Substanzen, welche an sich den vollen Dungwerth der behandelten Abfälle
besitzen.
Tafeln