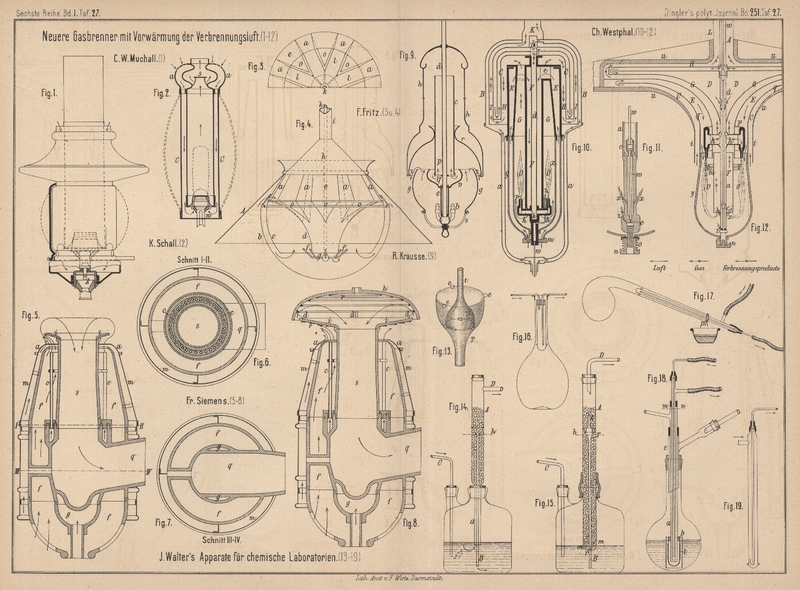| Titel: | Neue Gasbrenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft. |
| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 363 |
| Download: | XML |
Neue Gasbrenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft.
Patentklasse 4 bezieh. 26. Mit Abbildung auf Tafel 27.
Neue Gasbrenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft.
C. W.
Muchall in Wiesbaden (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 19353 vom 4.
August 1881) versieht seine Doppelcylindergaslampe mit einer Heizkammer A, welche nach Fig. 1 Taf.
27 in der Lampe selbst liegt. Dieselbe ist mit einem Regulator versehen und wird
durch die von oben eintretende, zwischen den beiden Cylindern stark erwärmte Luft
umspült und geheizt. Das von unten eintretende Gas, welches sich in dieser Kammer
verhältniſsmäſsig sehr langsam bewegt, findet in Folge dessen Zeit, die Wärme
aufzunehmen, so daſs dasselbe in erhitztem Zustande dem Brenner zuströmt, wodurch
eine vermehrte Leuchtkraft der Flamme erzielt wird (vgl. 1881 242 * 366).
Bei der Doppelcylinderlampe von K. Schall
in Stuttgart (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 19732 vom 26. Februar 1882) ist unter einem
gewöhnlichen Rundbrenner mit Cylinder ein Teller w
(Fig. 2 Taf. 27) angebracht, auf welchem ein weiterer Cylinder C aufsitzt. Diesem zweiten Cylinder kann auch die Form
einer ovalen Glocke gegeben werden, wie dies in der Zeichnung durch punktirte Linien
angedeutet ist, wodurch die Anbringung einer besonderen Glocke überflüssig wird.
Dieser doppelte Cylinder ist oben durch einen von dünnem Blech hergestellten Aufsatz
a gekrönt und der als Fortsetzung des inneren
Cylinders erscheinende innere Hut mit zwei Einschnürungen und einer Ausbauchung
versehen und überdies gerippt, um der daran vorbeiströmenden Luft eine möglichst
groſse Oberfläche zur Aufnahme der Wärme darzubieten. Im Inneren der genannten
Ausbauchung ist eine horizontale Scheibe s angebracht,
welche mittels einiger Drähte befestigt ist und den Zweck hat, den heiſsen Luftstrom
so viel als möglich mit der inneren Oberfläche der Ausbauchung in Berührung zu
bringen. Der äuſsere Metallhut bildet eine Fortsetzung des äuſseren Cylinders und
ist in seiner oberen Hälfte mit zahlreichen kleinen Löchern versehen, durch welche
die Luft auf die glühend heiſse Oberfläche des inneren Hutes durch den erhitzten
Zwischenraum zwischen dem inneren und äuſseren Hute bezieh. dem inneren und äuſseren
Cylinder zur Flamme strömt, um durch den inneren Cylinder wieder zu entweichen.
Die Gassparlampe von F.
Fritz in Berlin (* D. R. R Kl. 26 Nr. 20301 vom 3. Februar 1882) besteht im
Wesentlichen aus dem Lampenschirme A (Fig. 3 und
4 Taf. 27), der halbkugelförmigen, unten geschlossenen Glasglocke b, der unten offenen Glasglocke c, dem Reflectionskegel d, welcher unten bei
g offen ist und die Kammern o enthält. Hierüber liegt der Kegel e mit den
Oeffnungen a zur Erwärmung der Verbrennungsluft. Die
Luft tritt theils zwischen b und c, wie die Pfeile andeuten, direkt von unten mäſsig
erwärmt zur Flamme f, theils von oben in die beiden
Kegel d und e erhitzt bei
a ein, bei g zur
Flamme aus. Die Verbrennungsproducte entweichen durch die dreieckigen Kammern o in den Sammelkegel h und
in das Ventilationsrohr i; dabei erhitzen sich die
Kegel d und e und erwärmen
ihrerseits die von innen der Flamme zuströmende Luft. Die Kammern a sind oben durch den sternartig geschnittenen Deckel
l gegen den Sammelraum h abgedeckt. Das zuströmende Gas wird im Rohre k sowie im Inneren der Lampe im Kegel h und
in d erhitzt, worin zweckmäſsig auch ein Carbonisator
eingeschaltet werden kann.
Friedr.
Siemens in Dresden (* D. R. P. Kl. 4 Zusatz Nr. 22042 vom
5. September 1882) verwendet bei seinen Regenerativgasbrennern statt der früheren Luftzertheilungskammer (vgl.
1881 242 * 367) sogen. Leitflächen oder Curven, so daſs
die Aufsätze aus Porzellan oder anderem feuerfesten Materiale, sowie auch die
Lichtschützer aus Glas wegfallen können, indem die Flamme den nöthigen Halt und die
Führung durch die eigentümliche Form dieser Leitfläche erhält. Die Flamme wird
dadurch viel breiter, aber niedriger, einer Cascade gleich.
Das Brenngas wird, wie aus Fig. 5 bis
7 Taf. 27 ersichtlich, durch das Gasrohr in die Gaskammer g eingeführt, welche nach oben zu in einen Hohlring
ausläuft. Auf der oberen Fläche des Ringes sind die Gasröhrchen c vertikal im Kreise aufgestellt, aus deren oberen
Enden das Gas zur Verbrennung ausströmt und sich mit der Verbrennungsluft mischt.
Anstatt der Röhren kann man unter Umständen, namentlich bei Anwendung von schwerem
Oelgase, auch den Ring g bis zum oberen Ende der Röhren
verlängern und das Gas aus den an der oberen Fläche angebrachten Löchern direkt
entweichen lassen, in welchem Falle die Röhrchen c ganz
in Wegfall kommen.
Die Brennluft tritt, wie die Pfeile anzeigen, unten in den concentrischen Raum f (Regenerator genannt) ein, um letzteren von unten
nach oben durchstreichend oberhalb der Mündungen der Brennröhrchen c zu entweichen. Die so gebildete Flamme wird nun durch
die untere Leitfläche i aus Metall oder Porzellan
wieder nach auſsen getrieben und, dieselbe umschlieſsend, mittels der Saugwirkung
der Esse in einem groſsen Bogen wieder zusammengeführt, abwärts in den Essenhals s gezogen und durch das Seitenrohr q nach der Esse geführt.
Der Brennerkörper wird mit einem äuſseren Mantel m
umgeben, welcher, unten offen und oben ebenfalls mit Leitfläche a versehen, einen äuſseren zweiten concentrischen Luftraum freiläſst. Der
dadurch erzeugte vermehrte Auftrieb erwärmter Luft vergröſsert die regenerative
Wirkung der Oberflächen und wirkt auſserordentlich günstig zur Festigung und
Stetigkeit der Flamme selbst. Ein fernerer Vortheil dieses Mantels besteht darin,
daſs die äuſseren Flächen des Brennerkörpers verhältniſsmäſsig kühl erhalten
bleiben, in Folge dessen sich dieselben besser verzieren lassen und weniger Hitze
ausstrahlen, auch ohne durch die Wärme isolirende Materialien umkleidet zu sein. Die
Leuchtflamme, welche durch die eigenthümliche Form der Leitfläche gestaltet wird,
bedarf bei dieser Anordnung weder des Thonaufsatzes, noch des Lichtschützers aus
Glas.
Die in Fig. 8 Taf. 27 dargestellte Lampenform hat den Zweck, das Licht
vorzugsweise direkt nach unten zu werfen. Die obere Leitfläche i ist wesentlich vergröſsert, so daſs die Flamme nur
unterhalb dieser Fläche zur Entwickelung gelangt. Damit die Verbrennungsproducte
vollkommener am Umfange der groſsen Leitfläche nach dem Essenhalse s abgezogen werden, ist über der Leitfläche noch eine
Sammelhaube h angebracht. Diese besitzt Rippen oder
Vorsprünge d, welche auf der Leitfläche aufsitzen,
wodurch die centrische Stellung beider zu einander gesichert ist. Durch den zwischen
Leitfläche und Sammelhaube gebildeten ringförmigen Schlitz entweichen die
Verbrennungsproducte wie bei dem vorher beschriebenen Apparate nach dem Essenhalse
in das Seitenrohr q und endlich in die Esse.
Die groſse Leitfläche i soll auch gleichzeitig als
Reflector für das erzeugte Licht nach unterwärts dienen und wird daher am besten aus
Porzellan oder anderem reflectirenden und feuerfesten Materiale gemacht. Die
Sammelhaube muſs auch aus feuerfestem, aber Wärme schlecht leitendem Materiale
gemacht werden, damit die durch die Flamme entwickelte Wärme möglichst vollständig
in den Essenhals behufs Anwärmung des Regenerators gelangt. Sowohl Leitfläche, wie
die Sammelhaube müssen unter Umständen auf den mit der Flamme in Berührung kommenden
Flächen mit concentrischen Rippen r versehen werden, um
die direkte Berührung dieser Flächen durch die Flamme möglichst zu beschränken.
Ch.
Westphal in Frankfurt a.
M. (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 21809 vom 9. Mai
1882) will mit seinem Inlensivgasbrenner
eine möglichst groſse Vorwärmung der Gas- und Luftmengen durch die bei ihrer
Verbrennung in einem Leuchtbrenner entstehende Wärme erzielen. Die in Metall
ausgeführten Heizkammern der Luft und des Gases liegen oberhalb der Leuchtflamme und
sind so angeordnet, daſs dieselben möglichst auf ihrer ganzen Oberfläche von den
Verbrennungsproducten berührt werden, welche nebst der zur Verbrennung bestimmten
Luft mittels eines in der Achse des Leuchtbrenners angebrachten Kamines abgeführt
bezieh. angesaugt werden.
Bei der in Fig. 12
Taf. 27 skizzirten Hängelampe gelangt das Gas von oben
durch Rohr A in der Richtung der Pfeile in die
Heizkammern D und von hier durch Rohr d und h in den
Leuchtbrenner P und durch die Zündflamme z zur Entzündung. Der Stellring l ruht auf den Trägern m mit seiner Schneide
über der Mitte des Leuchtbrenners. Das gegen seine Schneide strömende Gas wird
hierdurch getheilt und gelangt derart in eine innigere Berührung mit der
zuströmenden Luft und so zu einer vollkommeneren Verbrennung. Die Luft tritt in der
Richtung der eingezeichneten Pfeile zwischen t und q in die äuſsere Heizkammer C aufwärts, in der inneren Heizkammer E
abwärts um den Brenner P in die Leuchtflamme O. Die Verbrennungsproducte steigen in der Richtung der
eingezeichneten Pfeile in dem aus Porzellan gefertigten Kaminhalse F aufwärts, durch G und
H in den Kamin L und
von hier ins Freie. Die äuſsere Luftheizkammer C sowie
die Kammer H der Verbrennungsproducte sind mit einer
Asbestlage u umgeben, um eine Abkühlung möglichst zu
verhüten. Die untere Asbestplatte u dient gleichzeitig
als Reflector und ist mit Wasserglas bestrichen, um das Ansetzen von Staub u. dgl.
möglichst zu vermeiden und ein Reinigen besser vornehmen zu können.
In das untere Ende a des Rohres d ist der Zünd- und Lockbrenner (vgl. Fig. 11)
eingeschraubt. Das Zündflammenspeiserohr w ist bei e in denselben eingedichtet. Es ist durch das
Gaszuleitungsrohr A, durch d und a geführt und mittels der
Ueberwurfmutter c mit dem im Zünd- und Lockbrenner
befestigten Theile verbunden. Das nach Oeffnen des Haupthahnes aus dem Brenner
strömende Gas tritt gleichzeitig aus den Oeffnungen x
des Lockbrenners und entzündet sich an der Zündflamme z. Der durch diese letztere im Kamin unterhaltene Zug wird hierdurch
gesteigert, das dem Leuchtbrenner entströmende Gas nachgezogen und an z und x entzündet. Die
Temperatur in den Abzugskanälen steigt nun rasch, theilt sich den Wandungen der
Heizkammern und schlieſslich dem Zündflammenspeiserohre mit. Da a aus Eisen, w aber aus
Messing gefertigt ist, dehnt letzteres sich stärker aus und preſst so die
Ueberwurfmutter c auf den Lockbrenner. Der Gaszutritt
zu diesem Brenner wird hierdurch aufgehoben und die Flammen x erlöscht. Hierdurch ist eine Gasvergeudung vermieden. Nach dem Erlöschen
des Leuchtbrenners und Erkalten des ganzen Apparates nimmt das Speiserohr für die
Zündflamme seine ursprüngliche Länge wieder an, hebt die Ueberwurfmutter von ihrem
Sitze und gestattet so dem Gase von neuem den Zutritt zu dem Lockbrenner. Die durch
die Schraube n gehaltene Spiralfeder o (Fig. 11)
trägt einerseits die Glocke y, andererseits gestattet
sie ein Nachgeben derselben bei der im Augenblicke der Entzündung stattfindenden
Explosion des dem Leuchtbrenner entströmenden Gases und verhindert so das
Zerspringen derselben.
Fig.
10 Taf. 27 zeigt einen Brenner, dessen
Gaszuführung von unten erfolgt. Das Gaszuleitungsrohr
theilt sich unterhalb des Brenners in zwei Arme a, welche in die
äuſsere Heizkammer B münden. Von hier gelangt das Gas
in den Vertheilungskörper D, dann in die Kammern C, erst ab-, dann aufwärts steigend, durch das Rohr d wieder abwärts durch die Vertheilungsröhren h in den Leuchtbrenner P.
Die Luft tritt durch die Oeffnungen der Schraube m
zwischen den Cylindern x und y aufwärts in die äuſsere Heizkammer E, von
hier durch e in die innere Heizkammer F abwärts um den Leuchtbrenner P in die Flamme O. Die Verbrennungsproducte
gelangen in der Richtung der Pfeile durch die Kammern G,
H und I in den Kamin K und von hier ins Freie. Die Schrauben m und
n tragen die Cylinder x und y. Das Zündflammenspeiserohr w ist in die Verlängerung des Leuchtbrennerkörpers k von unten eingeschraubt und in dem Cylinder x seitlich weitergeführt.
Der Intensivbrenner von R. Krausse
in Mainz (* D. R.
P. Kl. 26 Nr. 22185 vom 10. Oktober 1882) besitzt über dem durch einen
Kranz von Schnittbrennern gebildeten Brenner b (Fig.
9 Taf. 27) den Hohlkörper v, in welchen der
Cylinder c hineinragt, welch letzterer durch den Halter
q in die geeignete Höhe eingestellt wird. Ein
Schirm r aus Milchglas überdeckt den Obertheil der
Glocke g, jedoch mit Belassung eines Zwischenraumes z; der Schirm wird durch den dreitheiligen Halter h getragen. Die Gaszuführung erfolgt durch das Rohr d, welches auf der Strecke vom Brenner bis zum Körper
v mit einer Porzellanhülse e bekleidet ist.
Bei dieser Anordnung der Schnittbrenner vereinigen sich die Flammen derselben zu
einem Flammenringe, dessen Höhe so eingestellt ist, daſs er den Körper v nicht ganz erreicht. Die von unten durch das Sieb s zutretende Luft tritt zu der Flamme, und zwar
gleichmäſsig von innen und auſsen, beschreibt dann den durch den Pfeil p angedeuteten Weg um v,
um durch den Cylinder c angesaugt und abgeführt zu
werden. Da das Ansaugen erst dann genügend stark stattfindet, wenn der Cylinder c bedeutend erhitzt ist, so dient der Zwischenraum z zwischen r und g dazu, denjenigen Verbrennungsgasen, welche bei Beginn
der Beleuchtung durch den erst allmählich sich erhitzenden Cylinder noch nicht
angesaugt werden, einen Ausweg zu gestatten. Die durch c abziehende Verbrennungsluft wärmt das durch d zutretende Gas vor. Wird die Lampe mit Gaszuführung von unten benutzt,
so fällt die Vorwärmung des Gases weg.
(Schluſs folgt.)
Tafeln