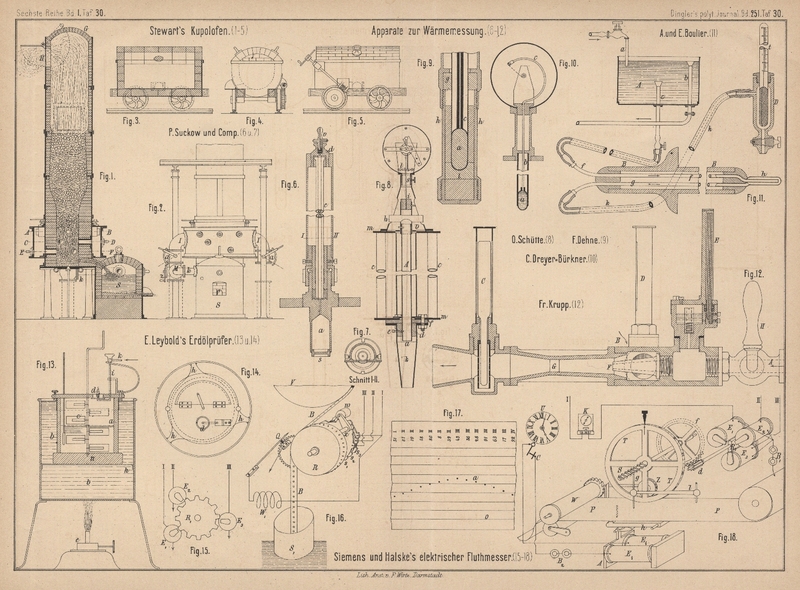| Titel: | Ueber neuere Wärmemessung. |
| Autor: | F. |
| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 412 |
| Download: | XML |
Ueber neuere Wärmemessung.
Patentklasse 42. Mit Abbildungen auf Tafel 30.
Ueber neuere Wärmemessung.
Bei dem Quecksilberthermometer von P. Suckow
und Comp. in Breslau (* D. R. P. Nr. 22250 vom 10. August
1882) läſst sich das schmiedeiserne Gefäſs a (Fig. 6 und
7 Taf. 30) nach Entfernung der Verschluſsschraube s sowohl von unten, als auch von oben nach Oeffnen des Ventiles d mit Quecksilber füllen. Der Hohlraum des Gefäſses a, sowie der Glasröhre c
ist derart gewählt, daſs bei der Maximalerwärmung, welche gemessen werden soll, das
Quecksilber die gewünschte Skalenlänge ausfüllt. Das Ventil v hat eine Längs- und Querbohrung; die Längsbohrung geht nicht durch,
sondern etwa 2 bis 3mm von der Verschluſsfläche
entfernt, woselbst die Querbohrung angebracht ist. Soll über der Quecksilbersäule
ein luftleerer Raum geschaffen werden, so ist die Luft durch Absaugen leicht zu
entfernen und kann während des Saugens das Ventil mit Leichtigkeit abgeschlossen
werden. Dieser Apparat soll hauptsächlich als Dampfwärmemesser bezieh. als Manometer
dienen.
Bei dem Fabrikthermometer von F. Dehne
in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 23845 vom 31. Januar 1883) ist, wie aus Fig. 9 Taf.
30 zu ersehen, der zwischen den Gummipfropfen g und l der eisernen Hülse h und
der mit dem Quecksilbergefäſse a zusammengeschmolzenen
Glasröhre c befindliche Raum zu etwa ⅔ seines Inhaltes
mit Quecksilber gefüllt. Kugel a und Röhre c sollen hier mit einem galvanischen Eisenüberzuge
versehen werden, damit das Thermometer von guten Wärmeleitern umgeben ist. Das Capillarthermometer von Dreyer-Bürkner in Quedlinburg (* D. R. P. Nr. 23633 vom 22.
November 1882) besteht, wie Fig. 10
Taf. 30 zeigt, aus dem Metallbehälter a und der damit
durch ein möglichst enges Rohr b verbundenen
Capillarfeder c. Dadurch soll erreicht werden, daſs die
Temperaturanzeige nur von der Ausdehnung des Quecksilbers im Behälter a abhängt.
Zum leichteren Ablesen des Thermometer Standes umgibt
M.
Rest in Augsburg (D. R. P. Nr. 24435 vom 11. April
1883) das Thermometer mit einer geschlossenen Glasröhre, welche mit
Aether oder Spiritus gefüllt wird.
P.
Schoop in Biebrich (D. R. P. Nr. 20345 vom 4. Februar
1882) empfiehlt ein Luftthermometer zur
Messung von hohen und niedrigen Temperaturen, bestehend aus einem Gefäſse, welches
ein trockenes Gas (Luft, Stickstoff o. dgl.) enthält und durch eine Capillare, deren
Hohlraum höchstens 0,1 Procent des Volumens des Gefäſses enthält, mit einer Bourdon'schen, mit Glycerin oder Oel gefüllten Röhre in
Verbindung steht und bei welchem die Temperaturanzeige dadurch vermittelt wird, daſs
der der jeweiligen Temperatur entsprechende Druck im Gefäſse durch die Capillare
weiter gelangt und mittels des Glycerins eine Gestaltsveränderung der Röhre bewirkt.
(Vgl. Codazza 1873 210 *
255.)
Bei dem Pyrometer von O. Schütte in
Noveant bei Metz (* D. R. P. Nr.
24781 vom 25. März 1883) ist das unten offene, 9mm weite und etwa 340mm lange Metallrohr A (Fig. 8 Taf.
30) auf etwa 30mm in den Kegel k eingeschoben und mit diesem und dem Verschluſsringe
d durch die Schraube e
fest verbunden. Die bei a einströmende heiſse Luft,
welche durch das
Querrohr h am oberen Ende des Rohres nach zwei Seiten
wieder abgeleitet wird, bewirkt nun in Folge der Endbefestigung des Rohres eine
Ausdehnung desselben in der Richtung des Zeigerwerkes, welche durch den in den
Endstopfen i eingesteckten Stift s direkt auf einen Daumenhebel l und von diesem durch Kette und Spiralfeder auf den Zeiger übertragen
wird. Der Apparathalter c besteht aus vier Metallröhren
von gleichem Querschnitte des Rohres A, welche oben und
unten durch eine quadratische Scheibe m mit einander
verbunden sind. Auf der oberen Scheibe ist der Aufsatz v aufgeschraubt, welcher zur Aufnahme des Zeigerwerkes dient. Um eine
Fortpflanzung der Wärme vom Aufstecker k auf den
Apparathalter c zu verhindern, ist zwischen beiden eine
Isolirschicht f von genügender Stärke angeordnet.
Bei dem Hobson'schen Apparate
zur Bestimmung der Temperatur des heiſsen Gebläsewindes (vgl. 1876 222 * 46) wird weder auf die Temperatur des kalten, noch
auf den Druck des heiſsen Windes Rücksicht genommen, so daſs keine zuverlässigen
Messungen damit ausführbar sind. Fr. Krupp in Essen (* D. R. P. Kl. 42
Nr. 24624 vom 7. April 1883) will diese Fehler durch die in Fig.
12 Taf. 30 dargestellten Abänderungen vermeiden.
Der heilte Gebläsewind tritt bei A in den Apparat und
wird mittels des Hahnes H und des Quecksilbermanometers
E (oder eines Manometers beliebiger anderer Art) so
regulirt, daſs der Druck des eintretenden heiſsen Windes stets constant erhalten
wird. Die Temperatur der bei B angesaugten kalten Luft
wird durch das Thermometer D angegeben, während die
Temperatur der entstehenden Mischung der heiſsen und kalten Luft an dem Thermometer
C abzulesen ist. Die Differenz der an C abgelesenen Temperatur des Luftgemisches gegen
diejenige der angesaugten kalten Luft, welche bei D
abgelesen wird, ergibt nun durch Multiplication mit einem constanten Coefficienten,
welcher von dem Gröſsenverhältnisse und der Stellung der beiden Düsen F und G abhängig ist und
zweckmäſsig an jedem Apparate durch Versuche ermittelt wird, um wie viel die
Temperatur des heiſsen Windes höher ist als diejenige der angesaugten kalten Luft.
Unter Anwendung einer verschiebbaren Skale am Thermometer C, welche auf Grund des ermittelten Coefficienten hergestellt ist und
deren Nullpunkt auf denjenigen Temperaturgrad eingestellt wird, welchen das
Thermometer D anzeigt, kann diese Temperaturdifferenz
direkt abgelesen werden.
Der Apparat kann auch umgekehrt in der Weise gebraucht werden, daſs bei A kalte Luft eingeblasen und dadurch bei B heiſse Luft angesaugt wird; hierbei ist das
Thermometer D in den bei A
eintretenden Kaltluftstrom einzuschalten.
Bei dem Pyrometer von A. Boulier
und E.
Boulier in Paris (* D. R. P. Nr. 25280 vom 1. April
1883) wird ein Wasserbehälter A (Fig.
11 Taf. 30) durch Rohr a und Ueberlauf b gleichmäſsig mit Wasser gefüllt erhalten. Das
Abfluſsrohr c ist durch einen Schlauch mit dem Rohre
f verbunden, so daſs das Wasser durch den
Metallbehälter h, das Rohr g und den Schlauch k zu dem Behälter D flieſst. Zum Einstellen des Thermometers t wird das Wasser im Behälter A auf 0° abgekühlt. Ist so der Nullpunkt festgestellt, so wird der von
einer Schutzhülle B umgebene Theil des Apparates auf
100° erwärmt und hiernach das Thermometer getheilt.
Die verschiedenen Röhren und Leitungen, sowie die Kammer des Indicators D sind entsprechend mit Wärme schlecht leitendem
Materiale umhüllt, um ein Ausstrahlen der Wärme zu verhüten. Selbstredend tritt eine
andere Skaleneintheilung ein, sobald die Strömung des Wassers eine veränderte wird,
d.h. wenn sich die Höhe des Wasserstandes über dem Ausflusse c ändert. Um ein selbstthätiges Verzeichnen der erreichten Hitzegrade zu
erzielen, wird hinter der Quecksilbersäule eine Walze angebracht, welche mit stark
lichtempfindlichem Jodsilberpapiere bespannt ist und sich mittels eines Uhrwerkes
innerhalb 24 Stunden einmal um ihre Achse dreht. Diese Walze steht aufrecht und ist
mit einem für Licht undurchlässigen Mantel umgeben, welcher direkt hinter der
Quecksilbersäule mit einem Schlitze durch seine ganze Länge hindurch versehen ist.
Die Lichtstrahlen fallen nun, durch die Quecksilbersäule gehemmt oder nicht gehemmt,
durch den Schlitz auf den lichtempfindlichen Cylinder und verzeichnen auf diesem
eine Curve, welche dem wechselnden Thermometerstande entspricht.
Ch. Lauth lobt diesen Apparat in den Annales industrielles, 1883 Bd. 2 S. 314. – Daſs auf
diese Weise einigermaſsen genaue Resultate erzielt werden, muſs Referent bestreiten.
Uebrigens ist dieses Pyrometer gegen das von K. Möller
(1880 236 * 309. 1882 246 *
374) wohl kaum als neu zu bezeichnen.
F.
Tafeln