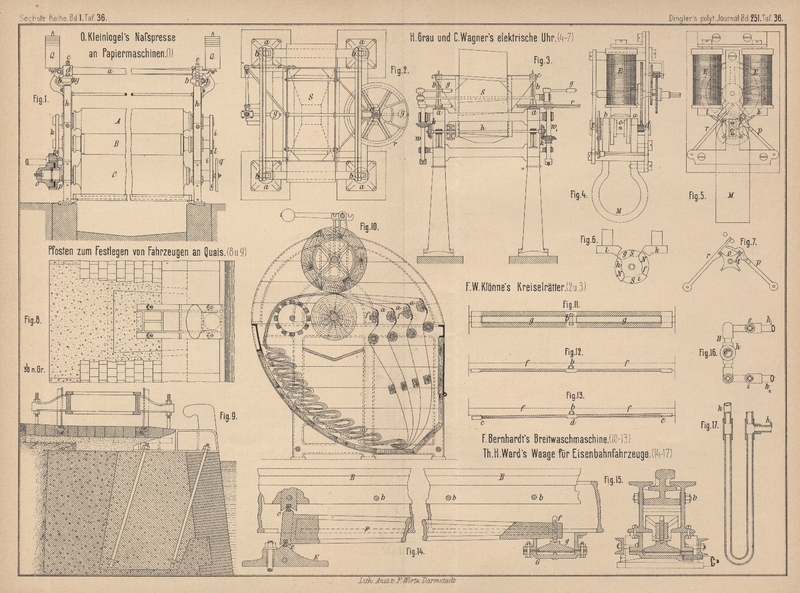| Titel: | H. Grau und C. Th. Wagner's elektrische Uhr. |
| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 492 |
| Download: | XML |
H. Grau und C. Th.
Wagner's elektrische Uhr.
Mit Abbildungen auf Tafel 36.
H. Grau und Th. Wagner's elektrische Uhr.
Die bereits in D. p. J. 1883 247 * 120 besprochene Uhr mit rotirendem Anker ist inzwischen von H. Grau unter Mitwirkung von C.
Th. Wagner in Wiesbaden noch weiter vervollkommnet worden; letzterer
änderte namentlich die Fangvorrichtung und die Stellung der Elektromagnete ab, der
erst Genannte fügte einen besonderen Sperrkegel hinzu. Die jetzige Anordnung dieses
elektrischen Zeigerwerkes ist nach der Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure, 1884 S. 62 in Fig. 4 bis
7 Taf. 36 dargestellt.
Zwischen den Schenkeln eines kräftigen, festliegenden Stahlmagnetes M ist der bei e und d (Fig. 4)
leicht drehbar gelagerte Anker angebracht: derselbe besteht aus zwei kreuzweise
gegen einander stehenden Eisenstücken, welche durch das zwischenliegende
Messingstück c unter sich und mit der Welle fest
verbunden sind. Die Eisenstücke sind von den inneren Flächen des Stahlmagnetes 0,5
bis 1mm entfernt und sind in Folge dessen durch
Influenz sehr stark magnetisch. Die den Polen des Stahlmagnetes M gegenüber stehenden Eisenstücke bilden also so zu
sagen bewegliche Polschuhe eines feststehenden Stahlmagnetes. Das neben dem Nordpole
a des Stahlmagnetes liegende Stück wird daher ein
Nordpol und das neben dem Südpole b ein Südpol. Von der
hinteren Seite (Fig. 6)
betrachtet, bilden die äuſseren Begrenzungslinien der Eisenstücke vier
sperrzahnartige Erhöhungen. Dieser Körper wird vor den Polen l und k eines Elektromagnetes E vermöge der ihm innewohnenden magnetischen Kraft
bestrebt sein, eine bestimmte Ruhelage gegen k und l einzunehmen, bei welcher die denkbar gröſste
Annäherung zwischen dem Anker und den Polen des Elektromagnetes erzielt ist. Geht
nun durch den Elektromagnet E ein passend gerichteter
Strom, so daſs k Nordpol und l Südpol wird, so wird k das Stück f abstoſsen und g
anziehen, l dagegen wird das Stück g abstoſsen und h
anziehen. Der Anker wird mithin ¼ Umdrehung machen. Um das Werk weiter zu bewegen,
ist es nöthig, einen dem ersten entgegengesetzt gerichteten Strom durch den
Elektromagnet zu schicken; in diesem Falle ist k ein
Südpol und l ein Nordpol. Der Südpol k wird also dann den Südpol g abstoſsen und den Nordpol h anziehen;
ferner wird der Nordpol l den Nordpol h abstoſsen und den Südpol i anziehen. Weil also die Uhr nur durch Wechselströme betrieben werden
kann (wie bei Hipp, vgl. 1878 227 * 558. 1883 247 * 489), so können auch die
durch Gewitter in den Lufteinleitungen inducirten Ströme, weil immer längere Zeit
gleich gerichtet, keine dauernden Störungen in einem Uhrennetze hervorbringen. Ein
solcher Inductionsstrom kann wohl, wenn er passend gerichtet ist, das Werk einmal
zum sprungweisen Gange bringen; dieses Vorgehen der Uhr um eine Minute wird aber
schon in der folgenden berichtigt, weil der dann von der Normaluhr kommende Strom
mit dem Inductionsstrome gleiche Richtung hat und deshalb die Uhr nicht weiter
bewegt.
Bei der Bewegung des Ankers kommt sowohl eine abstoſsende, als auch eine anziehende
Kraft zur Wirkung; da indessen die abstoſsende Kraft nur im ersten Theile der
Bewegung wirkt, so ist der erste Antrieb ein besonders kräftiger. Die Trägheit der
arbeitenden Theile, besonders der Zeiger, wird also mit Leichtigkeit überwunden.
Durch zweckentsprechende Veränderungen an den äuſseren Steigungscurven des Ankers
ist es gelungen, die Kraftentwickelung derart auf die einzelnen Bewegungsstufen zu
vertheilen, daſs die Kraft in jedem Augenblicke dem zu überwindenden Widerstände
annähernd proportional ist.
Die in Fig. 7 dargestellte Fangvorrichtung hat die Aufgabe, die Bewegung des
Ankers unter allen Umständen auf eine Vierteldrehung zu beschränken. Bei einer zu
kurzen Stromgebung könnte es nämlich sonst vorkommen, daſs der Elektromagnet bereits
aufgehört hätte, magnetisch zu sein, ehe der Anker seine Ruhelage erreicht hätte,
und es würde dann der sich mit groſser Geschwindigkeit bewegende Anker in der
Ruhestellung nicht aufgehalten werden, sondern dieselbe überschreiten. Solchen
Vorfällen soll die Fangvorrichtung vorbeugen. Mit der Achse c des Ankers ist ein Körper o fest verbunden,
welcher an seinen vier Ecken vorspringende Stifte trägt. In der Ruhelage des Ankers
nehmen diese Stifte die in Fig. 7
gezeichnete Stellung ein. Der Hebel p hat auf der
Rückseite seines oberen Endes eine tiefe Rille, durch welche der gerade darüber
stehende Fangstift in der Ruhestellung des Hebels frei hindurch gehen kann. Das
Spiel der Vorrichtung ist folgendes: Hat der Anker ungefähr das erste Drittel seiner
Bewegung zurückgelegt, so trifft einer der an o
befestigten Fangstifte die am oberen Ende des Hebels p
angebrachte Fläche; hierdurch wird der Hebel p
zurückgeworfen und, ehe er wieder seine Ruhelage einnehmen kann, stöſst der
Fangstift auf die Fläche t, wodurch die Bewegung des
Ankers nach vorwärts aufgehalten wird. Eine Rückwärtsbewegung ist dann auch nicht
mehr möglich, weil inzwischen der Sperrhebel r bereits
eingefallen ist. Diese Fangvorrichtung hat sich sehr gut bewährt; sie schützt das
Werk vollständig gegen die bei einer zu kurzen Contactgebung auftretenden
Störungen.
Bei den elektrischen Uhren mit rotirender Ankerbewegung wird die Bewegung des Ankers
durch einen Zahnradeingriff 1 : 15 oder, wenn eine absolute Feststellung der Zeiger
nöthig erscheint, durch eine Schraube ohne Ende auf die Zeigerachse übertragen.
Als charakteristische Eigenschaften des elektrischen Zeigerwerkes mit rotirender
Ankerbewegung gibt Verfasser folgende an: 1) Die elektrische Uhr mit rotirender
Ankerbewegung und polarisirtem Eisenanker bedarf keiner Regelung nach der
Stromstärke; sie geht sowohl mit einem, als auch mit 20 Leclanché-Elementen. 2) Bei der
groſsen Winkelbewegung des Ankers von 90° ist eine Fortbewegung der Zeiger durch von
auſsen wirkende Stöſse ausgeschlossen; aus demselben Grunde ist auch die Uhr
unempfindlich gegen kurz dauernde Inductionsströme. 3) Dauernde Störungen durch
atmosphärische Elektricität schlieſst der polarisirte Anker aus. 4) Remanenten
Magnetismus im Elektromagnete lassen die Wechselströme nicht auftreten.
Tafeln