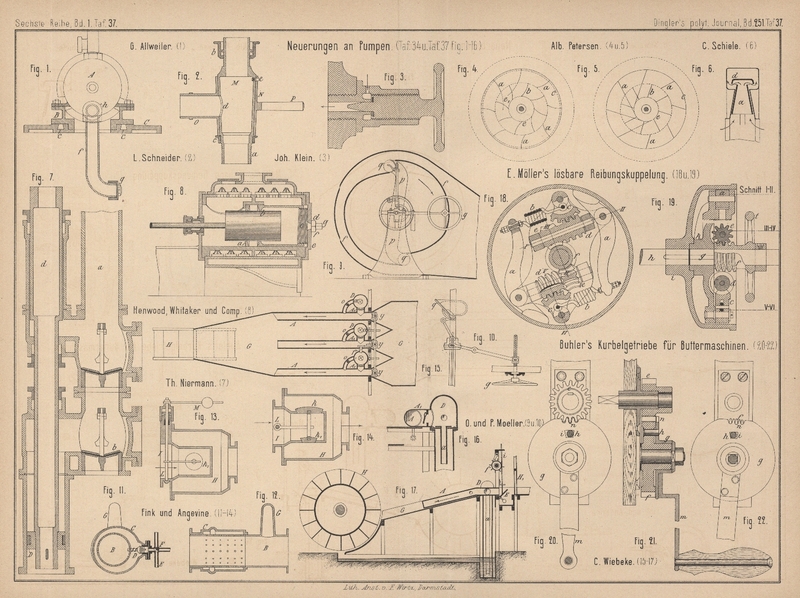| Titel: | K. Buhler's Kurbelgetriebe für Buttermaschinen u. dgl. |
| Fundstelle: | Band 251, Jahrgang 1884, S. 527 |
| Download: | XML |
K. Buhler's Kurbelgetriebe für Buttermaschinen u. dgl.
Mit Abbildungen auf Tafel 37.
K. Buhler's Kurbelgetriebe für Buttermaschinen.
Um bei den bekannten Buttermaschinen ein Emporheben der Flügelradwelle und dadurch
eintretende Ausrückung des auf ihr sitzenden Getriebes aus dem durch die Handkurbel
bethätigten Zahnrade zu verhindern, wird letzteres zuweilen mit einem Deckel
versehen, welcher die Zahnlücken noch überdeckt. Soll nun das Triebrad auf der
Flügelwelle entfernt werden, so muſs man zunächst diesen Deckel abnehmen. Um diese
immerhin zeitraubende Arbeit zu umgehen, hat K. E. Buhler in
Buttstädt (* D. R. P. Kl. 47 Nr.
25120 vom 5. Juni 1883) die nachfolgende in Fig. 20 bis
22 Taf. 37 dargestellte Einrichtung getroffen.
Die Kurbel m ist mit der Deckplatte g fest verbunden und mit dieser um die Nabe des
Zahnrades f lose drehbar. Die Mitnahme des letzteren
erfolgt mittels eines Zapfens h, welcher in einen
Schlitz i der Platte g
eintritt. An einer Stelle ihres Umfanges ist nun die Platte g mit Aussparungen n versehen, welche bei
zurückgedrehter Kurbel mit den Zahnlücken des Rades f
zusammenfallen und das Einschieben des Triebes e
gestatten, wie Fig. 20
zeigt. Der Spielraum des Zapfens h im Schlitze i ist nun aber so bemessen, daſs die Platte g sich beim Vorwärtsdrehen der Kurbel zunächst um eine
halbe Theilung gegen das Rad f verdreht, so daſs die
zwischen den Aussparungen n stehen gebliebenen
zahnförmigen Fortsätze über die Zahnlücken des Rades treten und ein Emporheben des
Triebes e auch an dieser Stelle beim Vorwärtsdrehen der
Kurbel verhindern.
Tafeln