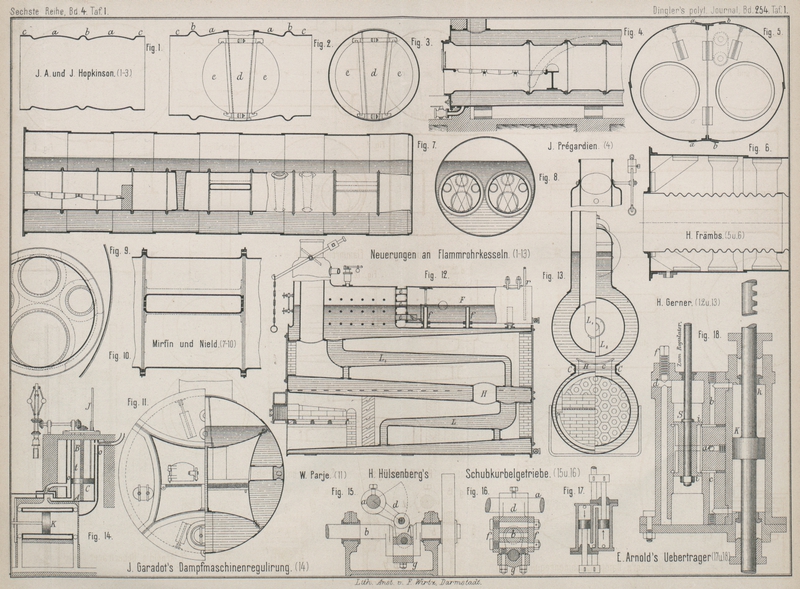| Titel: | J. Garadot's Regulirung von Dampfmaschinen. |
| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 9 |
| Download: | XML |
J. Garadot's Regulirung von Dampfmaschinen.
Mit Abbildung auf Tafel
1.
J. Garadot's Regulirung von Dampfmaschinen.
J.
Garadot in Neuville sur Saône, Frankreich (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 27711 vom 15.
November 1883) will die Regulirung von Dampfmaschinen dadurch bewirken,
daſs er die je nach der Belastung gröſsere oder geringere, für jeden Hub
erforderliche Dampfmenge vor dem Eintritte in den
Cylinder abmiſst. Zu dem Zwecke bringt derselbe zwischen Kessel und Arbeitscylinder
einen dem letzteren an Gröſse ungefähr gleichkommenden, ummantelten Cylinder an, in
welchem, wie aus Fig. 14 Taf. 1 zu entnehmen ist, ein durch Stangen t geführter Kolben C auf-
und abgeschraubt werden kann. Der Mantelraum o, sowie
der Innenraum B oberhalb des Kolbens stehen fortwährend
mit dem Kessel in Verbindung, sind also stets mit gespanntem Dampfe gefüllt. Aus dem
Mantelraume führt ein Rohr in einen besonderen, neben dem Arbeitscylinder
angebrachten Schieberkasten, von dessen Schieberspiegel ein nach dem unteren
Cylinderraume A leitender Kanal ausgeht. Kurz vor Ende
jedes Hubes wird der Raum A, in welchem der Schieber
H aus der gezeichneten Stellung nach links bewegt
wird, mit o in Verbindung gebracht, so daſs derselbe
sich gleichfalls mit Kesseldampf füllt. Gleich darauf erhält der Schieber wieder die
angegebene Lage, so daſs A von o abgesperrt ist und mit dem Einströmkanale des Arbeitscylinders in
Verbindung steht. Letzterer ist in gewöhnlicher Weise mit einer beliebigen Steuerung
(in der Zeichnung sind 4 Hähne angedeutet) versehen, welche, wie anzunehmen ist,
eine sich immer gleichbleibende Dampfvertheilung ergeben soll. Sobald die
Einströmvorrichtung geöffnet ist und der Kolben nach dem Hubwechsel vorrückt,
expandirt der Dampf gleichzeitig in A und hinter dem
Kolben K, bis kurz vor Ende des Hubes die
Einströmvorrichtung wieder geschlossen wird. Wenn die Geschwindigkeit der Maschine
sich ändert, so wird der Kolben C durch den Regulator
mittels eines indirekten Uebertragers in der angedeuteten Weise auf- oder abwärts
geschraubt, der Raum A also vergröſsert oder
verkleinert, in Folge dessen die Expansionscurve langsamer oder schneller fällt.
Im Wesentlichen ist also die Wirkungsweise wie bei einer Maschine, welche die Füllung
Null erhält und die einen sehr groſsen veränderlichen
„schädlichen Raum“ hat. Letzterer ist jedoch, weil er vor den Einströmvorrichtungen liegt und mit dem Ausströmkanale nie in
Verbindung kommt, nicht in dem Sinne und in dem Maſse schädlich zu nennen wie die gewöhnlichen todten Räume. Die
Volldruckwirkung des Dampfes fällt allerdings fort. Die Eintrittsspannung wird,
abgesehen von dem durch Ausfüllung des Einströmkanales entstehenden
Spannungsverluste, nahezu der Kesselspannung gleich sein. Die kleinste Füllung ist
gegeben durch den Rauminhalt des Kanales zwischen A und
dem Schieber H, während für die gröſste Füllung der ganze Inhalt des
Cylinders AB in Betracht kommt. Je nach der Gröſse
dieses Cylinders ist also eine Regelung innerhalb mehr oder weniger weiter Grenzen
möglich. Bezüglich der Dampfausnutzung mag diese Regulirung unter Umständen etwas
vortheilhafter sein als die allerdings bedeutend einfachere durch Drosselung.
Der Cylinder AB soll, wenn möglich, mit seinem Mantel in
einen an die Feuerzüge des Dampfkessels angeschlossenen Heizraum eingehängt werden,
wodurch einerseits wohl eine wirksame Trocknung des Dampfes und namentlich auch eine
Wärmemittheilung während der Expansion erreicht wird, andererseits aber die
Aufstellung der Maschine in nächster Nähe des Kessels nöthig wird. – Eine an dem
Kolben C befestigte, nach oben durch eine Stopfbüchse
geführte Stange J läſst an einem Maſsstabe jederzeit
den Stand des Kolbens erkennen.
Tafeln