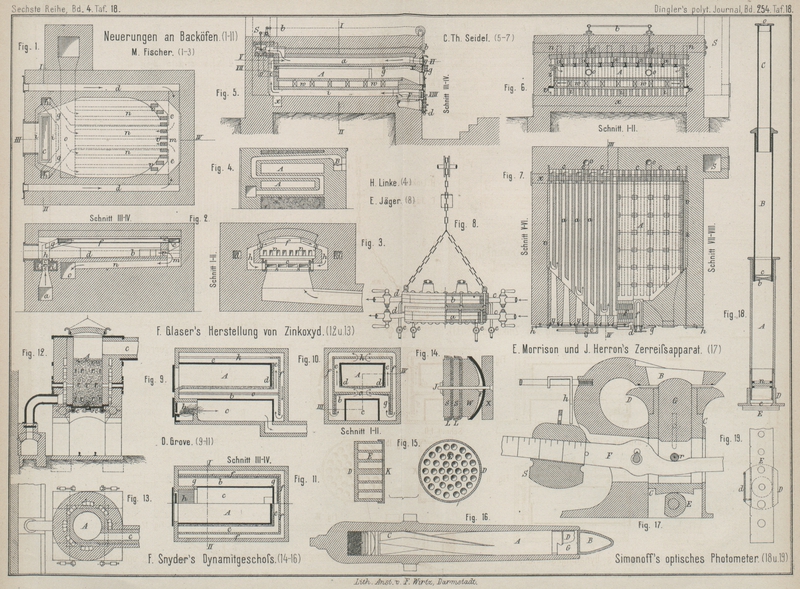| Titel: | Ueber Neuerungen an Backöfen. |
| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 250 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Backöfen.
(Patentklasse 2. Fortsetzung des Berichtes Bd. 247
S. 30.)
Mit Abbildungen auf Tafel
18.
Ueber Neuerungen an Backöfen.
M.
Fischer in Berlin (* D. R. P. Nr. 22987 vom 13. Januar 1883) will bei seinem Backofen mit Gasfeuerung durch geeignete Zuführung
erhitzter Verbrennungsluft zu den Brenngasen eine so hohe Wärme erzielen, daſs der
Ofen sehr bald die erforderliche Temperatur von 200 bis 250° hat. Die Brenngase
werden dem Ofen durch den Kanal a (Fig. 1 bis 3 Taf. 18) zugeführt,
welcher nahe der vorderen Stirnseite des Ofens in diesen hineinreicht und sich nach
der Herdsohle b in der ganzen Breite derselben mittels
einer schlitzartigen Mündung c öffnet. Die zur
Verbrennung erforderliche Luft gelangt durch mit Schiebern versehene Kanäle d in den Ofen und wird durch Röhren e, f und g dicht unter dem
Gewölbe des Ofens geführt und dabei durch die Generatorgase erhitzt. Endlich gelangt
die Luft seitlich des Mundloches durch Kanäle h in die
längs der Mündung c des Kanales a befindlichen Röhren i und strömt durch
Längsschlitze s in die Mündung, um sich mit den
Brenngasen zu mischen. Die Verbrennungsgase entweichen durch Oeffnungen v in den Raum m und aus
diesem durch Kanäle n unterhalb der Herdsohle nach vorn
in den Sammelkanal o, welcher mit dem Schornsteine in
Verbindung steht. Ist der Ofen genügend erhitzt, so werden die Zuführungen der
Brenngase und der Verbrennungsluft abgesperrt und auſserdem die Mündung c durch einen Deckel in Höhe der Herdsohle wie auch
durch Sanddichtung abgeschlossen.
Der Nutzen, welchen die Vorwärmung der Luft in den Rohren e,
f und g bringt, wird übrigens nicht groſs
sein, da die an die Luft übertragene Wärme doch dem Backraume selbst entnommen
wird.
Nach H. Linke in Breslau (* D. R. P. Zusatz Nr. 26393
vom 14. Februar 1883, vgl. 1883 247 * 30) kann die
seitlich angebrachte Oberfeuerung R, wie Fig. 4 Taf. 18
zeigt, auch für mehrere über einander liegende
Backräume A angewendet werden.
H.
Hilke in Wien (* D. R. P. Nr. 23948 vom 31. December 1882) hat bei sogen. Etagen-Backöfen zur Ermöglichung eines ununterbrochenen
und sparsamen Betriebes zwei Feuerungen angebracht, deren jede mit dem die
Backherdräume umgebenden Heizkanalsysteme in Verbindung steht, also mit der anderen
abwechselnd in Verwendung kommen kann, während eine zwischen der unteren
Backherdsohle und den Feuerungen angeordnete Fluſskieselschicht als Wärmespeicher
dient und die Temperatur auch bei unterbrochener Zufuhr von Heizmaterial durch
längere Zeit auf gleicher Höhe hält. – Die ganze Anlage zeichnet sich nicht gerade
durch Einfachheit aus.
C. Th.
Seidel in Dresden (* D. R. P. Nr. 27496 vom 18. November 1883) stellt an Backöfen mit Unterfeuerung die Sohle des Backraumes
möglichst dünn her, damit die Hitze leicht an letzteren abgegeben wird. Der Backraum
A (Fig. 5 bis 7 Taf. 18) ruht mit seiner
Sohle auf parallele Kanäle i bildenden Steinen, während
der eigentliche Backherd durch Steinwürfel in einiger Entfernung von der Sohle
gehalten wird, so daſs der Hohlraum w entsteht. Zu
beiden Seiten des Backraumes A werden die Kanäle z gebildet, durch welche die in dem Räume w durch die in den Kanälen i hinziehenden Feuergase erhitzte Luft aufsteigt und in den Backraum A eintritt. Die Sohle des Raumes c ist an beiden Seiten mit einer Oeffnung versehen, die
mittels durch Handhebel h stellbare Klappen v verschlossen werden kann und durch welche die Hitze
nach beendigter Feuerung direkt in den Hohlraum w
bezieh. A geleitet werden kann.
An die Kanäle i, unter welchen sich im hinteren Theile
des Ofens ein Reinigungskanal x quer hinzieht,
schlieſsen sich die an der Backraumrückwand aufsteigenden Kanäle c an, welche bis zu den über der von Längs- und
Quereisenträgern getragenen Backraumdecke liegenden Kanälen a mit Reinigungsöffnungen y führen. Die
Kanäle c und a sind derart
eingerichtet, daſs die in je zwei Kanälen i und c hinstreichende Hitze in je einem der Kanäle a nach vorn geht, dort umkehrt und in einem zweiten der
Kanäle a nach hinten streicht, wie linksseitig in Fig. 7 durch
Pfeile angegeben ist, um in den in den Schornstein S
einmündenden Sammelkanal n zu entweichen. Von der
Wasserpfanne e führt ein Rohr d nach dem Dampfentwickler f. Das Rohr g bringt den Dampf in den Backraum A, während die in den Sammelkanal n ausmündende Dampfableitung o durch Kegelventile und Zugvorrichtung b
geregelt wird.
A.
Wikart in Einsiedeln, Schweiz (*
D. R. P. Nr. 23568 vom 31. Januar 1883) schlägt einen
Backofen vor, dessen Backraum von einer eisernen Muffel gebildet wird, welche von einer zweiten
Muffel umgeben ist, so daſs der so entstandene Hohlraum mit einer bei 250 bis 300°
oder darüber siedenden Flüssigkeit angefüllt werden kann, um die Wärme der zu
backenden Waare zu übertragen. Diese Flüssigkeit (z.B. eine Salzlösung, wie etwa
Chlorzink oder Fette und Oele, Glycerin, schwere Kohlenwasserstoffe, leicht flüssige
Metalle oder Legirungen) wird entweder indirekt auſserhalb des eigentlichen Ofens,
oder direkt durch den äuſseren Mantel umspülende Heizgase erwärmt und dient somit
nicht nur zum Uebertragen der Wärme, sondern auch zur Wärmeaufspeicherung.
E.
Jäger in Plauen bei Dresden (* D. R. P. Nr. 26945 vom 27. Juni 1883) will sich zum Backen,
der Hitze des gespannten Dampfes in Hohlplatten
bedienen. Bei den zu diesem Zwecke verwendeten Hohlplatten oder Backformen ist die
untere Hohlplatte a (Fig. 8 Taf. 18)
feststehend, die obere Hohlplatte b abhebbar, was
mittels über Rollen geführter Ketten und eines Gegengewichtes bewirkt wird. Behufs
dichten Schlusses der Hohlplatten auf einander kann die obere mit Gewichten belastet
werden. In die Hohlplatten tritt durch die Rohrleitung c Dampf ein, welcher mit dem Condensationswasser bei d abströmt. Es können auch zur gesonderten Ableitung
des niedergeschlagenen Wassers Röhrchen e angebracht
werden.
Der Teig wird bei gehobener Platte b auf die Platte a gegossen, die Platte b
dann wieder niedergelassen, mit Gewichten belastet und der Dampf in die vorher
bereits gut geheizten Platten so lange eingelassen, bis der Backprozeſs vollendet
ist. Nach Entfernung der Gewichte und Heben der Platte b läſst sich das Gebäck von a leicht abheben.
Die Hohlplatten können auch an einem Ende mit einem Gelenke verbunden und durch
entsprechende Klemmvorrichtungen verschlossen werden.
Die mit diesem Verfahren angestellten Versuche sollen in der Waffelbäckerei ergeben haben, daſs mit Dampf von 6at Druck der Backprozeſs sich fast ebenso schnell
vollzieht wie bei Anwendung direkter Hitze des Feuers, wobei in Betracht zu ziehen
ist, daſs der hohe Druck die Anfertigung der Formen mit hohlen Wänden aus starkem
Eisenblech erfordert, durch welche hindurch die Hitze des Dampfes auf den
Teigübertragen werden muſs.
Allerdings wird auf diese Weise das Verbrennen des Gebäckes völlig verhütet; dennoch
wird das Verfahren wohl nur beim Groſsbetriebe in Frage kommen können.
D.
Grove in Berlin (* D. R. P. Nr. 27830 vom 30. Oktober 1883) will bei Backöfen
die erforderliche Wärme durch überhitzte Luft aus einer Luftheizkammer derart zuführen, daſs die heiſse Luft durch Kanäle
veranlaſst wird, von auſsen um den Backraum herum zu kreisen, die Wärme an denselben
abzugeben, nach unten zu fallen und sich von Neuem an der unterhalb des Backraumes in der
Luftheizkammer angeordneten Heizvorrichtung zu erhitzen und das Spiel ununterbrochen
zu wiederholen.
Unter dem eigentlichen Backraume A (Fig. 9 bis 11 Taf. 18) befindet sich
eine Luftheizkammer b, deren Luft durch einen mit
Feuerung h versehenen Heizapparat c erhitzt wird. Die erhitzte Luft der Luftkammer b steigt durch den Spalt o
unter den Backraum A und vertheilt sich von hier in die
Kanäle e, welche denselben an den Seiten und oben
umgeben. Nachdem die erhitzte Luft an den Backraum A
ihre Wärme abgegeben hat, gelangt dieselbe durch den Spalt k in die Kanäle f, fällt in denselben nach
unten, um der Luftheizkammer b wieder zugeführt und
durch den Heizapparat wieder erwärmt zu werden. Die Wände des Backraumes A sind mit einem Materiale bekleidet, welches Wärme
schlecht leitet und, wie in der Zeichnung bei d
gezeigt, da am stärksten ist, wo die erhitzte Luft die höchste Temperatur hat, und
da entsprechend geringer, wo dieselbe schon abgekühlt ist. Die Kanäle f für die herabsinkende Luft sind gegen die strahlende
Wärme des Heizapparates c durch die Schichten g geschützt, so daſs ein umgekehrter Luftstrom bezieh.
eine Wirbelbildung nicht stattfinden kann.
Tafeln