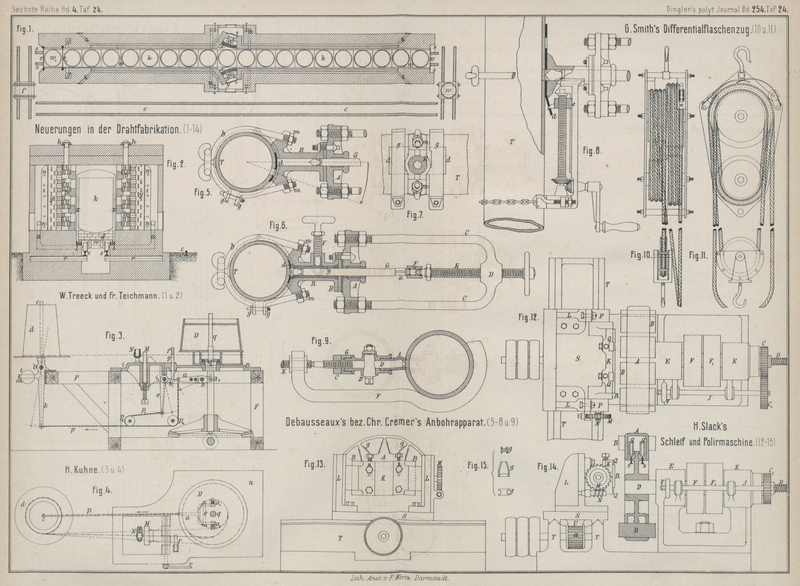| Titel: | H. Slack's Schleif- und Polirmaschine. |
| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 335 |
| Download: | XML |
H. Slack's Schleif- und Polirmaschine.
Mit Abbildungen auf Tafel
24.
H. Slack's Schleif- und Polirmaschine.
Der wichtigste Theil einer Schleifmaschine, die Schleifscheibe, bildet bei der zum
Schleifen und Poliren ebener Flächen bestimmten Maschine von E. Slack
in Sheffield (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 26791
vom 25. April 1883) zugleich das wesentlich Neue. Die Scheibe besteht aus
einem Guſskörper A (Fig. 12 bis 14 Taf. 24),
in welchem segmentförmige Blöcke B des Schleif- oder
Polirmaterials durch Keilstücke g (Fig. 15) festgeklemmt
werden; das Anstellen der letzteren erfolgt mittels Schrauben s. Die Schleifblöcke können aus natürlichem oder
künstlichem Schleifsteine, Schmirgel o. dgl. hergestellt sein. Die Art und Weise,
wie dieselben im Scheibenkörper befestigt sind, ermöglicht ein bequemes Nachstellen
nach starker Abnutzung, sowie auch die Auswechselung unbrauchbar gewordener Stücke
gegen neue.
Die Schleifscheibe A ist mit ihrer Achse D in dem festliegenden Spindelstock E gelagert; zum Antriebe der Spindel D sitzen auf derselben Voll- und Leerscheibe F, F1. Parallel zur
Stirnfläche der Schleifscheibe wird auf dem Bette T der
Schlitten S mittels Zahnstange U und Getriebe a in bekannter Weise hin und
her bewegt. Der Schlitten S trägt den Ständer L mit Lagern P, in denen
die Zapfen des Rahmens K ruhen, auf welchem das
Arbeitstück R mittels der Backen Q aufgespannt ist. Der Rahmen K läſst sich also, entsprechend der notwendigen Lage des Arbeitstückes
gegen die Schleifscheibe, neigen und dient hierzu das auf einem der Rahmenzapfen
befestigte Schneckenrad M und die Schraube N, welche letztere mit Hilfe eines Schlüssels gedreht
wird. Um nun die Schleifscheibe gegen das Arbeitstück einzustellen, wird dieselbe
gegen das letztere hin verschoben. Zu diesem Zwecke ist die Scheibenspindel D mit Gewinde versehen, zu welchem die Nabe des an
Verschiebung gehinderten Stirnrades C die Mutter
enthält. Das Rad C1 auf
der Achse J des Handrades V greift in das Rad C ein. Durch Drehung des
Handrades V kann somit die Verschiebung der
Schleifscheibe gegen das Arbeitstück bewirkt werden.
Tafeln