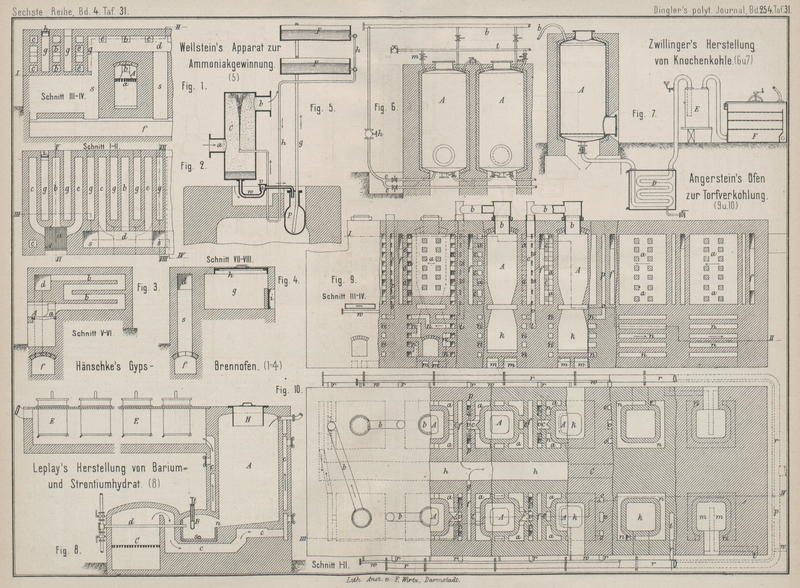| Titel: | Leplay's Verfahren zur Herstellung von Barium- und Strontiumhydrat. |
| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 436 |
| Download: | XML |
Leplay's Verfahren zur Herstellung von Barium- und
Strontiumhydrat.
Mit Abbildung auf Tafel
31.
Leplay's Herstellung von Barium- und Strontiumhydrat.
H.
Leplay in Paris (* D. R. P. Kl. 75 Nr. 28757 vom 13. Oktober 1883) will zur
Herstellung der Hydrate des Bariums und Strontiums Wasserdampf, welcher höher
erhitzt ist, als der Schmelzpunkt der Hydrate liegt, durch Barium- oder
Strontiumcarbonat leiten, so daſs die gebildeten Hydrate sofort ablaufen.
Man füllt die eisernen Töpfe E (Fig. 8 Taf. 31) mit in
Formen gepreſstem Barium- oder Strontiumcarbonat und feuert dann den Ofen C an, bis die zur Dampfüberhitzung bestimmten Rohre d rothglühend geworden und selbst die Töpfe E zur schwachen Rothglut gebracht sind. Man bringt nun
eines der Gefäſse E in geeigneter Weise zu der oberen
Oeffnung der Retorte A, läſst es bis auf den Boden
derselben herab und löst mittels Kette den beweglichen Boden des Gefäſses E und zieht es wieder herauf, so daſs sein Inhalt
zurückbleibt. Sobald in dieser Weise die Retorte A
genügend beschickt ist, schlieſst man die Oeffnung H
mit ihrem Deckel und läſst Dampf in die Heizrohre d
treten, welcher überhitzt nach der Kammer B strömt. Zur
Erkennung der erforderlichen Temperatur ist hier ein schmiedeisernes Rohr t eingesetzt, welches mit Barium- oder Strontiumhydrat
gefüllt ist. Der überhitzte Dampf tritt in die von Heizkanälen c eingeschlossene Retorte A und erhitzt das hier lagernde Carbonat bis zur Zersetzung und zur
Bildung von Hydrat, welches sofort in Fluſs geräth und durch die Oeffnungen n in die Kammer B flieſst.
Dieses geschmolzene Hydrat führt eine gewisse Menge unzersetztes Carbonat mit sich,
welches auf der geschmolzenen Hydratschicht schwimmt. Wenn man darauf achtet, die
Kammer B zu ¾ zu füllen, was mit Hilfe in der Wand
angebrachter Schaulöcher leicht zu bewerkstelligen ist, so vollendet der durch B streichende überhitzte Dampf die Ueberführung des
vorhandenen Carbonates in geschmolzenes Hydrat. Ist die Kammer B vollständig mit geschmolzenem Hydrate angefüllt, so
entfernt man den Zapfen, welcher die Oeffnung s
verschlieſst, und läſst das geschmolzene Hydrat in eiserne Formen auslaufen.
Inzwischen sind die mit zusammengeballtem Carbonate wieder gefüllten Gefäſse E so warm geworden, daſs sie nach Bedürfniſs der
Retorte A, welche ohne Unterbrechung im Betriebe sein
muſs, aber nur mit Unterbrechungen aus den Gefäſsen E
beschickt werden kann, das Carbonat liefern können. – Die erhaltenen Verbindungen sollen namentlich
zur Gewinnung von Zucker verwendet werden.
Nach dem Zusatzpatente * Nr. 29153 vom 13. Januar 1884 hat Leplay gefunden, daſs die betreffenden Carbonate, mit 30 bis 40 Proc.
Wasser gemengt, zu Kugeln oder hohlen Cylindern geformt werden müssen, welche in
geschlossenen Gefäſsen plötzlich der Rothglühhitze ausgesetzt werden, da sie beim
langsamen Trocknen wieder aus einander fallen. Dasselbe ist aber auch der Fall, wenn
die auf schwache Rothglut erhitzten Cylinder einem unter 110° heiſsen Dampfstrome
ausgesetzt werden, so daſs man die Temperatur der erhitzten Stücke immer über 110°
halten muſs. Es hat sich ferner gezeigt, daſs die geschmolzenen Hydrate etwa 25
Proc. Carbonate lösen können, ohne daſs das Ausflieſsen gehemmt wird. Die
Zersetzungstemperatur der Carbonate liegt der Schmelztemperatur des Guſseisens
nahe.
Die Trennung des in geschmolzenem Zustande befindlichen Barium- oder
Strontiumhydrates von dem nicht zersetzten Carbonate kann dadurch erleichtert
werden, daſs man dem Carbonate eine gewisse Menge kaustisches Kali oder Natron
beifügt. Zu diesem Zwecke setzt man dem Wasser, welches zur Herstellung der
Formstücke dient, Aetzkali oder Aetznatron zu. Fügt man statt dessen Alkalicarbonate
hinzu, so werden diese ebenfalls in Hydrate verwandelt. Dieses Verfahren kann
gleichzeitig zur Darstellung von Kalium- und Natriumhydrat dienen, indem man das Gemenge der
geschmolzenen Hydrate mit Wasser auslaugt und dabei hinlänglich concentrirte
Aetzkali- oder Aetznatronlaugen erhält, in welchen Aetzbaryt oder Aetzstrontian fast
unlöslich sind. – Der neuere Apparat ist in der Anordnung der Retorte A und Kammer B
vereinfacht.
Tafeln