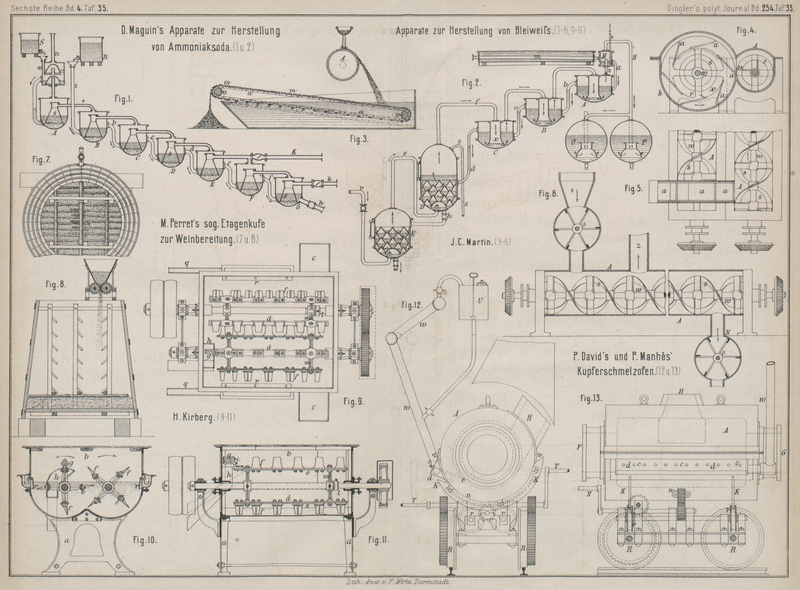| Titel: | Apparate zur Herstellung von Bleiweiss. |
| Fundstelle: | Band 254, Jahrgang 1884, S. 489 |
| Download: | XML |
Apparate zur Herstellung von
Bleiweiſs.
Patentklasse 22. Mit Abbildungen auf Tafel 35.
Apparate zur Herstellung von Bleiweiſs.
Um das für die Bleiweiſsfabrikation bestimmte Blei zu granuliren, läſst J. C.
Martin in Richmond, England (* D. R. P. Nr. 28322 vom 31. August 1883) dasselbe auf einen
drehbaren Cylinder fallen, unter welchem drehbare Schaber angebracht sind, um das
anhaftende Blei abzustreichen. Auſserdem kann, um das Anhaften des Bleies auf dem
Cylinder zu erschweren, durch eine mit Kautschuk oder Leder überzogene Walze auf den
Cylinder Graphit oder Speckstein übertragen werden. (Vgl. Martin 1880 237 * 244.)
Die Bleikügelchen sollen von dem Cylinder A (Fig. 3 Taf. 35)
auf eine bewegliche Unterlage fallen; dieselbe besteht aus zwei endlosen,
flachgliedrigen, um Walzen v laufenden Ketten a, welche durch angenietete Latten m in passender Entfernung von einander gehalten werden.
Das von der Walze A auf das endlose Lattentuch m fallende Blei wird durch dasselbe aus dem Wasser
entfernt.
Das fertige Bleiweiſs soll in einer Reihe geschlossener Cylinder A (Fig. 4 bis 6 Taf. 35) getrocknet
werden, wovon jeder eine aus Kupferbändern hergestellte Schnecke s zum Vorschieben des Bleiweiſs enthält, Der
Einfalltrichter t führt zu einer cylindrischen Kammer,
in welcher sich eine Welle o langsam dreht, auf der mit
Leder besetzte Platten sitzen, um das einfallende Bleiweiſs langsam den
Trockencylindern zuzuführen. Die cylindrische Kammer k
bildet eine vergröſserte Fortsetzung der Röhren A und
enthält ein auf der Welle w befestigtes Schaufelrad r. Die Schaufeln a sind so
gestellt, daſs bei ihrer Drehung in der Pfeilrichtung das Bleiweiſs aus der Kammer
k in das Ende des zweiten Troges geschafft wird.
Ist somit das Bleiweiſs am Ende des ersten Rohres angekommen, so fällt dasselbe in
die Kammer k durch die Oeffnung x in den Seiten des Rades r und durch die
Räume zwischen den Schaufeln a, so daſs beim
Weiterdrehen des Schaufelrades das Bleiweiſs an dem inneren Umfange der Kammer k hochgetragen wird, bis dasselbe durch die Oeffnung
u in den zunächst liegenden Trog a fällt. Hier wird das Bleiweiſs durch eine Schnecke
s in umgekehrter Richtung geführt und verläſst
schlieſslich den Apparat durch die Oeffnung N des
letzten Troges. Die zum Trocknen bestimmte heiſse Luft tritt durch einen Stutzen
oben auf der einen Seite im Cylinder ein und entweicht auf der anderen Seite durch
ein Rohr z.
Der Waschapparat zur Trennung des Bleiweiſs von
unangegriffenem Blei von H. Kirberg in
Hilden bei Düsseldorf (* D. R. P. Nr.
28528 vom 9. Januar 1884) soll wirksamer sein und weniger leicht in
Unordnung kommen als der von Harn (vgl. 1883 247 * 81) angegebene Apparat. Wie aus Fig. 9 bis 11 Taf. 35 zu ersehen
ist, nimmt der auf Guſsfüſsen a aufgeschraubte, oben in
der ganzen Breite mittels Holzdeckels verschlossene kupferne Bottich b durch die an den letzteren angenieteten Trichter c die in ihre Bestandtheile zu trennende Oxydmasse
sowie die dazu nöthige Schlemmflüssigkeit auf. Die beiden mittels Riemenscheibe und
zweier Zahnräder nach der Mitte des Apparates hin sich drehenden Haspel d bewirken mittels der auf die Längsleisten e derselben aufgeschraubten Wurfschaufeln f ein inniges Durcheinanderwühlen und dadurch ein
schnelles Trennen der Oxydmasse in ihre einzelnen Bestandtheile.
Die durchlöcherte muldenförmige Auswurfschaufel g,
welche die von Oxyd befreiten Bleitheile vom Boden des Bottiches aufnimmt und in den
Ausfalltrichter h wirft, ist an ihrem oberen Ende auf
einem am Arme i festsitzenden Bolzen drehbar, wogegen
dieselbe am unteren Theile mittels Schraube, je nach der zu benöthigenden
Auswurfmenge, nach vorn oder hinten gestellt werden kann. Um ein langsames oder
schnelles Waschen von hartem bezieh. weichem Oxyde herbeizuführen, wird die
Kuppelung l geöffnet, wodurch das lose auf der Achse
sitzende Haspelkreuz m etwas gedreht werden kann,
indessen das zweite Kreuz fest bleibt, so daſs dadurch die Haspelleisten e und die Wurfschaufelflächen in eine Schrägstellung
zur Längsrichtung des Apparates gebracht werden, wodurch die Geschwindigkeit der
Fortbewegung der Massen nach der Auswurfseite geregelt wird. Nach der gewünschten
Verstellung der Längsleisten e wird die auf jeder der
beiden Achsen sitzende Kuppelung l wieder geschlossen
und durch Festschrauben gegen selbstthätiges Lösen gesichert. Das mit Bleioxyd geschwängerte
Waschwasser flieſst durch die in der Höhe der Flüssigkeit liegenden Siebe o in vorgenietete, mit Klappendeckel geschlossene
Kästen durch die Rinnen q in die Schlemmbottiche ab.
Die vor den Sieben o hängenden und behufs leichter
Reinigung derselben leicht zu entfernenden, unten offenen Schutzkästen r verhindern ein Eindringen von kleinen metallischen
Bleitheilen in die Siebe, indem die Bewegungsrichtung der Oxydmasse und somit auch
etwa mitgerissene metallische Bleitheile an den Seitenwänden des Apparates nach
unten gehen. (Vgl. Kirberg 1884 253 * 296.)
Tafeln