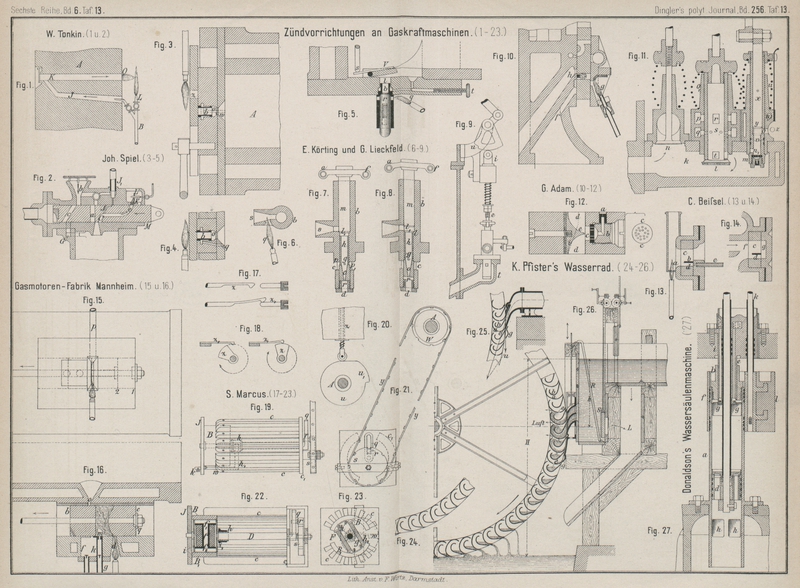| Titel: | K. Pfister's Wasserrad. |
| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 208 |
| Download: | XML |
K. Pfister's Wasserrad.
Mit Abbildungen auf Tafel
13.
Pfister's Wasserrad.
Das Bestreben, bei Wasserrädern die Wahl kleinerer Durchmesser und gröſserer
Umfangsgeschwindigkeiten bezieh. Umlaufzahlen ohne Beeinträchtigung des
Wirkungsgrades zu ermöglichen, hat K. Pfister in
Freising bei München (* D. R. P. Kl.
88 Nr. 29199 vom 15. Februar 1884) auf den Gedanken gebracht, bei
rückschlächtigen Rädern einen Theil des Gefälles durch Actionswirkung und den Rest
durch Wirkung des Aufschlagwassers vermöge seines Gewichtes auszunutzen (vgl. Zuppinger 1884 252 *
190).
Das diesem Grundsatze entsprechend ausgeführte Rad ist, wie Fig. 26 Taf. 13
veranschaulicht, durch einen ganz eigenthümlichen Schaufelbau gekennzeichnet. Jede der beiden genannten Wirkungen erfolgt an
besonderen Schaufeln: die Actionswirkung an den entsprechend gekrümmten Schaufeln
a, an welchen das Wasser entlang gleitet, um
schlieſslich in die darüber liegende Schaufel b
überzustürzen, in welcher es bis zum Austritte durch sein Gewicht wirkt. Der
Austritt selbst wird dadurch, daſs die beiden Schaufeln a und b sich am äuſseren Radumfange bis auf
einen sehr engen Spalt nähern, verhältniſsmäſsig sehr spät erfolgen, weil das Wasser
nur unter einem gewissen Drucke durch den Spalt ausflieſsen kann, ein Umstand,
welcher den Wirkungsgrad des Rades erhöhen muſs.
Die Umfangsgeschwindigkeit u wird am vortheilhaftesten
so im Verhältnisse zur Austrittsgeschwindigkeit c des
Wassers aus dem Leitapparate (Coulisseneinlaufe) angenommen, daſs das Wasser beim
Verlassen der Actionsschaufel gerade noch so viel Geschwindigkeit besitzt, um in die
obere Schaufel bezieh. Zelle übertreten zu können. Pfister setzt gewöhnlich: c=0,85\,\sqrt{2\,g\,h} bis
0,9\,\sqrt{2\,g\,h} und u ∾ 0,5
c. Da aber trotzdem etwas Wasser in der
Actionsschaufel zurückbleiben wird, welches der Schaufelform wegen sehr bald zum
Ausgieſsen käme, so ist durch kleine Löcher bei e dem
Wasser das Ablaufen von der Actionsschaufel in die darunter befindliche Zelle b ermöglicht. Zur Erreichung desselben Zweckes kann
auch die Actionsschaufel a etwas gegen die darunter Hegende Schaufel b zurückgesetzt sein (vgl. Fig. 24), so daſs bei
tiefer Neigung das Wasser durch den Spalt zwischen den beiden Schaufeln zurücktreten
kann.
Da kein Radboden vorhanden ist, hat die durch das eintretende Wasser verdrängte Luft
freien Austritt. Beim Leitapparate kann die oberste Schaufel in Führungen beweglich
angeordnet werden, um bei veränderlichen Wassermengen von Hand oder durch einen
Regulator selbstthätig verstellt zu werden. Das unter dem Leitapparate angebrachte,
entsprechend gebogene Blech g soll beim Einlaufe
allenfalls verspritztes Wasser noch den unteren Schaufeln zuführen.
Die Schütze S dient sowohl als Leerschütze, als auch als
Reinigungsvorrichtung für den Rechen R, indem bei
zeitweiligem Oeffnen derselben durch die groſse Ausfluſsgeschwindigkeit des Wassers
die vor dem Rechen lagernden Verunreinigungen mit in den Leerlauf L gerissen werden.
Fig. 25 zeigt
einen Einlauf in Verbindung mit einer Rohrleitung für gröſsere Gefälle und kleinere
Wassermengen.
Tafeln