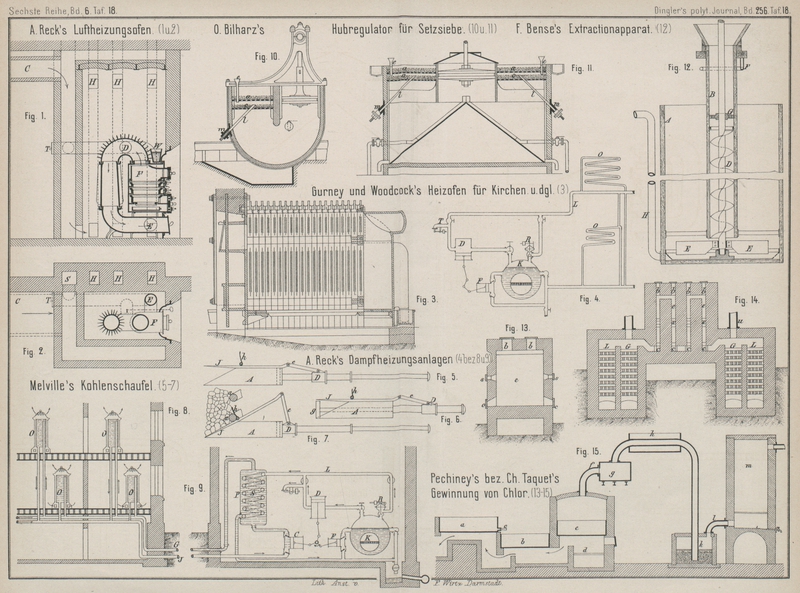| Titel: | Zur Gewinnung von Chlor. |
| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 274 |
| Download: | XML |
Zur Gewinnung von Chlor.
Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 18.
Zur Gewinnung von Chlor.
Zur Verwerthung der Chlorcalciumrückstände der
Ammoniaksodafabrikation für die Erzeugung von Chlor werden dieselben nach Ch.
Taquel in Chauny, Frankreich (* D. R. P. Nr. 30 839 vom 17. Juni 1884) mit reiner
Kieselerde und Mangansuperoxyd erhitzt; die Zersetzung erfolgt nach der Gleichung:
CaCl2 + MnO2 +
2SiO2 = 2Cl + CaSiO3 + MnSiO3.
Die Concentration der Chlorcalciumlaugen wird in einer guſseisernen Pfanne a (Fig. 15 Taf. 18) bis zum
Erscheinen krystallinischer Chlorcalciumhäutchen bewirkt. Alsdann läſst man nach
Herausziehen des Pfropfens c die concentrirte
Flüssigkeit in das Gefäſs b laufen, um dieselbe völlig
zur Trockne zu bringen. 500k Chlorcalcium werden
gepulvert mit ungefähr 450k gepulvertem
Mangansuperoxyd und 550k Kieselsäure gemischt.
Diese Mischung wird alsdann auf der Platte e aus
feuerfesten Steinen ausgebreitet und mittels des Herdes d bis zur Rothglut erhitzt. Das Chlor entweicht durch das Rohr f in die aus feuerfesten Steinen hergestellte Kammer
g, kühlt sich in dem Kühlgefäſse h ab und gelangt in einen Steintrog k, welcher Wasser und Mangansuperoxyd enthält. Wenn nämlich das
Chlorcalcium noch etwas Wasser enthält, so bildet sich gleichzeitig Chlor und
Salzsäure: 2CaCl2 + H2O + MnO2 + 3SiO2 = 2Cl + 2HCl + MnSiO3 + 2CaSiO3.
Indem nun das Gemisch beider Gase auf Mangansuperoxyd einwirkt, zersetzt sich die
Salzsäure in Chlor und bildet Manganchlorür nach der Formel: MnO2 + 4HCl = MnCl2 +
2H2O + 2Cl. Das so erhaltene Chlor geht durch
Rohr l in den mit Chlorcalcium gefüllten Thurm m, um es dann in bekannter Weise zur Bildung von
Chlorkalk zu verwenden.
Nach Pechiney und Comp. in Salindres (*
D. R. P. Nr. 30841 vom 1. Juli 1884) werden die Chlorüre des Mangans, Magnesiums u. dgl. behufs
Zersetzung in vier mit Schaulöchern s versehene
senkrechte Arbeitskammern e der in Fig. 13 und 14 Taf. 18
skizzirten Ofenanlage eingetragen. Die zum Heizen dieser Kammern bestimmten
brennenden Gase durchziehen dieselben abwechselnd bald nach der einen, bald nach der
anderen Richtung, wie dies bei allen Regenerativöfen der Fall ist. Die Wärmespeicher
G und L befinden sich
auf jeder Seite des Ofens. Wenn eine hinreichende Wärmemenge in den Kammern
aufgespeichert ist, schlieſst man sie einerseits gegen die Feuerung, andererseits
gegen den Schornstein ab. Die zu erhitzende Masse wird alsdann durch die mit Deckeln
versehenen oberen Oeffnungen b eingefüllt und später,
ohne daſs dieselbe mit den Verbrennungsgasen in
Berührung gekommen ist, durch die unten angebrachten Thüren c wieder herausgeschafft.
Soll die Masse der Einwirkung der Luft oder irgend eines anderen Gases ausgesetzt
werden, so wird dieses in den Ofen durch den unteren Theil eines der Wärmespeicher
L eingeführt und entweicht entweder allein, oder
mit etwaigen gasförmigen Reactionsproducten gemischt durch das an der
entgegengesetzten Seite befindliche Rohr w, nachdem es
die 4 Arbeitskammern nach einander durchzogen hat.
Der Ofen wird auch zum Glühen von Natriumbicarbonat, zur
Herstellung von Kokes u. dgl. in Aussicht genommen.
Tafeln