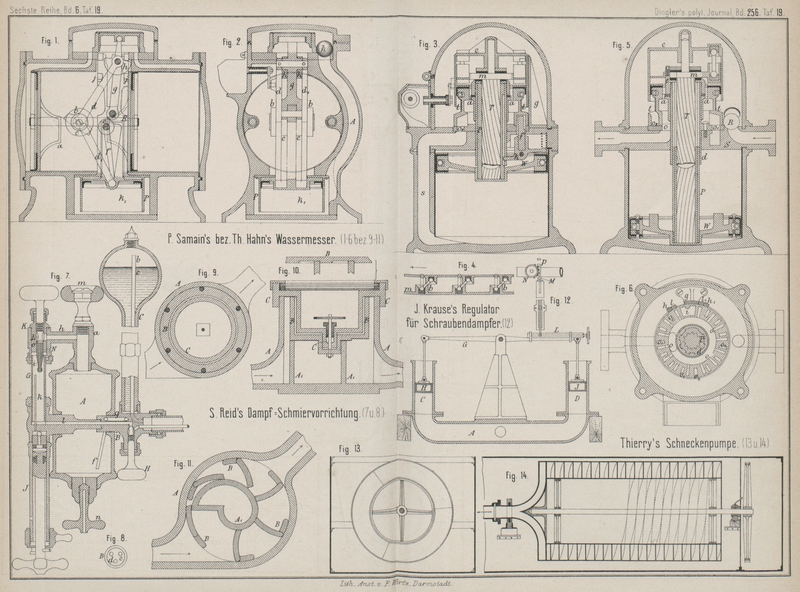| Titel: | Sam. Reid's selbstthätig wirkende Dampf-Schmiervorrichtung. |
| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 296 |
| Download: | XML |
Sam. Reid's selbstthätig wirkende
Dampf-Schmiervorrichtung.
Mit Abbildungen auf Tafel
19.
Reid's selbstthätig wirkende Dampf-Schmiervorrichtung.
Eine recht sinnreiche, wenn auch etwas umständliche Construction zur ununterbrochenen
Schmierung von Dampfkanälen, Schieberkasten u. dgl. hat Sam. Reid
in Chicago (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 28680
vom 26. Februar 1884) angegeben; dieselbe besitzt die Eigenthümlichkeit,
daſs das Zuflieſsen des Oeles durch den Dampfdruck selbst bewirkt wird und daſs man
zugleich durch ein Flüssigkeitstandsglas den Gang des Apparates zu beobachten
vermag.
Ein cylindrischer Oelbehälter A (Fig. 7 Taf. 19) wird durch
ein mit Schraubenverschluſs versehenes Rohr a zunächst
vollständig mit Oel gefüllt. Zu beiden Seiten dieses Gefäſses sind zwei mit einander
durch das Gefäſs A hindurch in Verbindung stehende
Gefäſse angebracht, rechts der Condensator C, links das
Flüssigkeitstandsglas G, an welches unten eine kleine
Luftpumpe J angefügt ist. Der Condensator C steht durch zwei ungleich lange Rohre h und c, welche in
Bohrungen d und e (Fig. 8) des
Körpers B münden, mit der Dampfleitung in unmittelbarer
Verbindung, die durch einen in der Figur nicht sichtbaren, nach hinten liegenden
Hahn unterbrochen werden kann. Ist diese Verbindung offen, so tritt Dampf in den
Condensator, schlägt sich hier jedoch sofort nieder und flieſst vom Boden durch ein
in das Innere des Raumes C reichendes Rohr fg in das Gefäſs A ab,
woselbst sich das Wasser als specifisch schwerer am Boden ansammelt und das Oel nach
oben drängt. Das Oel gelangt nun durch den Kanal b in
ein mit ⊤-förmiger Bohrung versehenes Stück K, in
welchem ein Hahn L lothrecht verstellbar ist. Derselbe
ist mit einer Längsbohrung i und einer senkrecht zu
derselben stehenden Querbohrung o versehen. Wird dieser
Hahn geöffnet, so kann durch die beiden Bohrungen o und
i Oel in den Flüssigkeitstandszeiger G gelangen; letzterer besteht aus einem oben und unten
gegen Luftzutritt in ähnlicher Weise wie bei Wasserstandsgläsern abgedichteten
Glasrohre G, in welches ein dünnes Rohr k aus der unterhalb befindlichen Luftverdichtungspumpe
mündet. Diese Pumpe, deren allgemeine Einrichtung und Handhabung aus der Figur zur
Genüge ersichtlich ist, hat den Zweck, in dem Glasrohre G einen Luftdruck herzustellen, welcher um ein wenig gröſser ist als der
in der Dampfleitung herrschende gröſste Dampfdruck. Das aus dem Rohre i abtropfende Oel sammelt sich am Boden des Glases ff
und gelangt von hier durch den Kanal l in eine mittels
Hahn H gleichfalls verschlieſsbare Oeffnung in dem
Stücke B und von hier durch das Abfluſsrohr G in die Dampfleitung. Das Eintreten in letztere ist
durch den im Glase G herrschenden Ueberdruck möglich.
Damit jedoch ein Austreten des Oeles in das Glas G
durch den Hahn N möglich ist, muſs der auf dem Oele in
dem Gefäſse A
lastende Druck ebenso
groſs oder gröſser sein als der Luftdruck in G, was
durch die im Condensator C allmählich sich ansammelnde
Wassermenge erreicht wird, deren Druck auf die untere Fläche des Oeles im Gefäſse
A zu dem in der oberen Kuppel von C herrschenden Dampfdruck hinzukommt. Durch das hinter
dem Rohre b liegende, etwas weniger hoch stehende Rohr
c wird ein regelmäſsiger Abfluſs des
Wasserüberschusses ermöglicht. Durch die 3 Hähne m, n
und den in der Kuppel von C befindlichen Hahn ist ein
Entleeren bezieh. Füllen des ganzen Apparates möglich, während durch richtiges
Einstellen der Hähne L und H ein gleichmäſsiger Gang des Apparates erzielt werden kann.
Wenngleich die dem erwähnten Apparate zu Grunde liegende Idee eine recht gute zu
nennen ist und derselbe in neuem Zustande wohl vortrefflich wirken mag, so lassen
sich doch die Bedenken nicht unterdrücken, daſs durch die vielen kleinen Bohrungen
ein Verstopfen und Undichtwerden des Apparates fast unvermeidlich erscheint, sowie
daſs derselbe vermöge seiner verwickelten Construction beträchtlich theurer als
andere gleichgut wirkende Apparate ist.
Tafeln