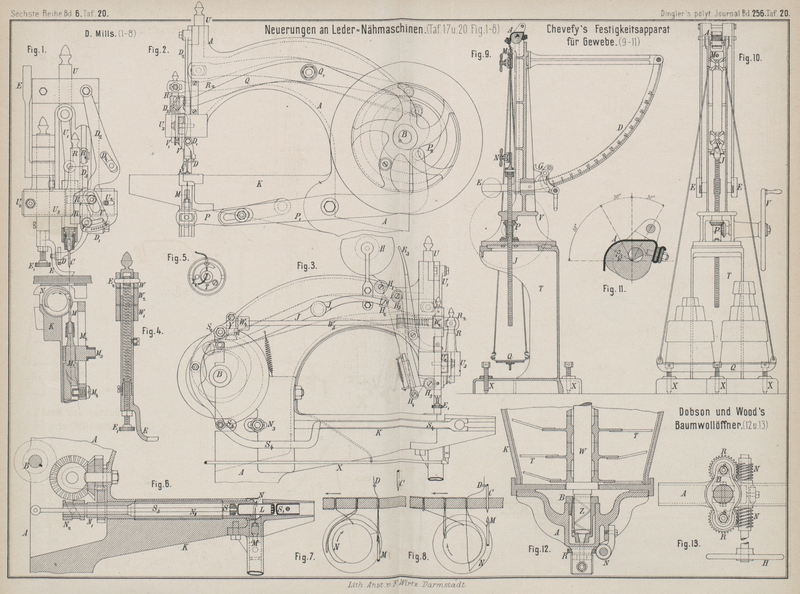| Titel: | Dobson und Wood's Neuerungen an stehenden Baumwollöffnern. |
| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 304 |
| Download: | XML |
Dobson und Wood's Neuerungen an stehenden
Baumwollöffnern.
Mit Abbildungen auf Tafel
20.
Dobson und Wood's Baumwollöffner.
Bei den auch nach seinem Constructeur Crighton benannten
stehenden Baumwollöffnern, wo in einem kegelförmigen Roste eine mit dieser Form
entsprechend immer gröſseren Schlägerscheiben versehene Welle in schnelle Drehung
versetzt wird, hängt die Wirkung auf die eingebrachte Baumwolle ebenso wohl von der
Weite der Rostöffnungen, als auch von der Entfernung der Schlägerspitzen von der
Rostfläche ab.
Es bedarf deshalb bei der nach einander folgenden Behandlung verschiedener
Baumwollsorten eines Austausches des Rostes oder der Schlägerscheiben. Die Vornahme
einer solchen Auswechselung nimmt jedoch immer lange Zeit in Anspruch und wird
deshalb bei den von Dobson und Barlow in Bolton
ausgeführten Crighton'schen Baumwollöffnern nach den
Angaben von Dobson und Wood (vgl. Textile Manufacturer, 1884 S. 521)
der Abstand der Schlägerspitzen von der Rostfläche der zu öffnenden Baumwolle
entsprechend durch eine Verstellung der Schlägerwelle
in der Senkrechten, also ohne Austausch von Theilen der Maschine herbeigeführt.
Zu diesem Zwecke läuft der Fuſszapfen Z der
Schlägerwelle W, wie aus Fig. 12 und 13 Taf. 20 zu
entnehmen ist, in einer Büchse B, welche von zwei
Schrauben s getragen wird und in dem festen Tragstücke
A gelagert ist. Die zwei Schrauben s besitzen als Schneckenräder R ausgebildete Muttern, welche gleichzeitig von einer auſserhalb des
Maschinengestelles mit dem Handrade H versehenen Welle
und den Schnecken N gedreht werden, wodurch die
Schlägerwelle W gehoben und gesenkt wird. Die so
ermöglichte Senkung der Schlägerwelle ist noch von Vortheil, wenn sich die Schläger
T an ihren Spitzen durch den Gebrauch abgenutzt
haben, da immer der erforderliche Abstand vom Roste K
eingehalten werden kann.
Bei der bisherigen Schmierung des Fuſslagers kamen
entweder bei ungenügender Oelzugabe bei der hohen Geschwindigkeit und wegen Drehung
des stählernen Fuſszapfenendes auf den untergelegten glasharten Stahllinsen leicht
groſse Erhitzungen und dadurch Veranlassungen zu Entzündungen der Baumwolle vor,
oder aber es führt zu reichliches Einölen, welches wegen der Unzugänglichkeit des
Lagers während des Ganges der Maschine nicht ordentlich nachgesehen werden kann, zur
Verschwendung des Schmiermaterials. Bei der neuen Ausführung erhält der Fuſszapfen
Z eine schraubengangförmige Spur, in welcher das
aus dem als Behälter dienenden Tragstücke A durch
Löcher in die Büchse B am Ende zutretende Oel in die
Höhe befördert wird und dabei die ganze Lagerfläche der Büchse B ordentlich benetzt. Von oben kann das Oel dann durch
einen kleinen Kanal wieder in den Behälter zurücklaufen. Der Behälter A ist durch Röhren mit einem auſsen am
Maschinengestelle angebrachten Standrohre aus Glas verbunden, welches die Menge und
Beschaffenheit des Oeles beobachten, und mit einem Ablaſshahne versehen, welcher das
schlecht gewordene Oel abflieſsen und neues zugieſsen läſst.
Die dem Ballen entnommene Baumwolle gelangt nicht sofort wie bisher durch ein Rohr in
den Trichterrost, sondern erst auf einem Lattentuche und durch zwei grobe
Stachelcylinder zu einer Stachelwalze, welche die einzelnen Flocken erst etwas
auflöst und lockert. Unter dieser Stachel walze ist ein Rost angeordnet, durch
welchen ein Theil der Schalen und des Schmutzes der Baumwolle schon abgestreift
wird. Der Baumwollöffner wird auch mit einer einfachen Schlagmaschine verbunden, so
daſs man die geöffnete Baumwolle in Wattenform erhält, womit eine Verminderung der
Feuersgefahr verknüpft ist, da Baumwolle in losem Zustand leichter Feuer fängt, als
wenn sie zusammengepreſst oder verdichtet ist.
Tafeln