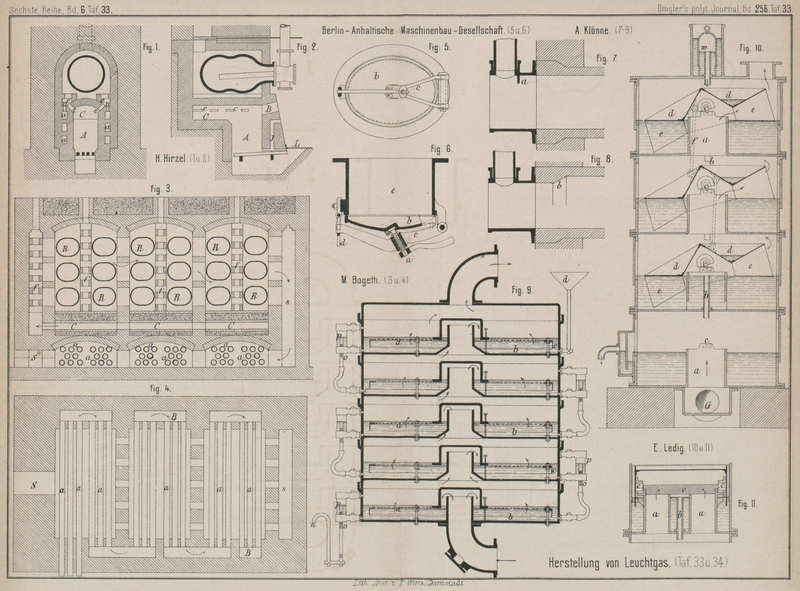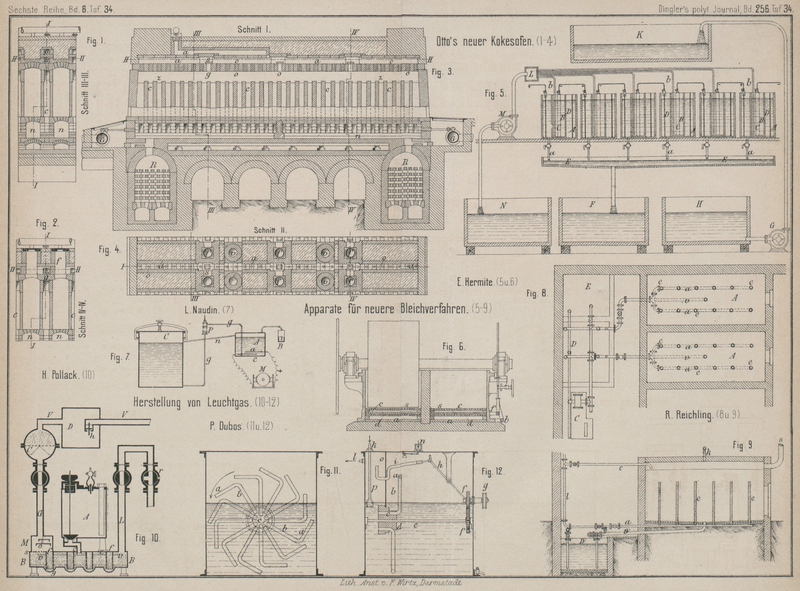| Titel: | Ueber die Herstellung von Leuchtgas. |
| Fundstelle: | Band 256, Jahrgang 1885, S. 541 |
| Download: | XML |
Ueber die Herstellung von Leuchtgas.
(Patentklasse 26. Fortsetzung des Berichtes S. 171
d. Bd.)
Mit Abbildungen auf Tafel
33 und 34.
Ueber die Herstellung von Leuchtgas.
H.
Hirzel in Plagwitz-Leipzig (* D. R. P. Nr. 30745 vom 19. Juni 1884) will Retortenöfen zur Herstellung von Oelgas mit Gasfeuerung versehen. Das Heizgas, welches in dem durch
die verschlieſsbare Oeffnung B (Fig. 1 und 2 Taf. 33) gefüllten
Generator A gebildet wird, geht von dem Sammelkanale
C aus durch Schlitze c
in die Mischkanäle e, in welche auch die in den Kanälen
a vorgewärmte Verbrennungsluft durch Schlitze v eintritt. Die zur Vergasung erforderliche Luft tritt
durch Kanal J in den Generator über dem Roste ein,
während der Aschenfall durch Platten L geschlossen
bleibt.
R. Chesebrough in New-York (Nordamerikanisches Patent
Nr. 306810) will die zum Entfärben von Kohlenwasserstoffen, Oel u. dgl. gebrauchte
Knochenkohle durch Zuführungswalzen in erhitzte
Cylinder einführen, so daſs während des langsamen Hinunterrutschens in denselben die
Oele u. dgl. aus der Knochenkohle in Leuchtgas
übergeführt werden.
Nach M.
Bogetti in Asti (* D. R. P. Nr. 30303 vom 3. Mai 1884) soll die Wärme der
abziehenden Rauchgase zur Erhitzung der
Verbrennungsluft verwerthet werden. Die Scheidewände der die Retorten R (Fig. 3 und 4 Taf. 33) enthaltenden
Oefen sind durchbrochen, damit die Feuergase hindurchgehen können, während die
Heizschächte f von oben, wie beim Hoffmann'schen Ringofen mit Gruſskohlen, Kokesabfällen
u. dgl. befeuert werden. Die Verbrennungsgase entweichen vom Sammelkanale s zum Fuchse S und
erhitzen die Rohre a, durch welche die Verbrennungsluft
hindurchzieht, um stark vorgewärmt durch Kanäle B und
C in die Feuerungen f
zu treten.
Die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actiengesellschaft in
Berlin (* D. R. P. Nr. 30881 vom 16.
September 1884) benutzt bei ihren Retortenmundstücken, Feuerthüren u. dgl. eine Schraube, welche die Achse
des Verschlusses derart schneidet, daſs der Verschluſsdeckel beim Schlieſsen wie
beim Oeffnen eine gleitende Bewegung auf der Dichtfläche annehmen muſs. Wie aus den
Skizzen Fig. 5
und 6 Taf. 33
hervorgeht, findet, nachdem der Deckel b mit dem Bügel
c durch den Ueberwurf d gegen das Mundstück e angelegt ist, das
Anpressen des Deckels durch die Schraube a statt.
Nach A. Klönne in Dortmund (* D. R. P. Zusatz Nr. 30 860
vom 27. Mai 1884, vgl. 1884 253 * 469) werden Steigrohrverstopfungen auch dadurch vermieden, daſs man im
Retortenkopfe oder in der Retorte einen Ansatz anbringt, so daſs ein Theil des Gases
zwischen den Kohlen und der Retortenwandung zum Stehen gebracht wird. Auf diese
Weise tritt diese Gasschicht als Isolator zwischen der heiſsen Retortenwandung und
zwischen dem Kohlenraume auf, so daſs nicht so viel Wärme aus dem Ofen in den
Gasraum dringen kann. Das Gas kann nicht überhitzt werden und geht mit seiner
niedrigen Temperatur und seinem Theer- und Wassergehalte in die Steigrohre. Dieser
Ansatz wird nach Fig. 7 bei a fest an den Retortenkopf
gegossen, oder es wird nach Fig. 8 bei b der Ansatz in der Retorte gebildet, oder es wird eine
bewegliche Klappe unten am Steigrohre befestigt.
Bei dem von A. Klönne angegebenen und in Fig. 9 Taf. 33
veranschaulichten Colonnenwascher (* D. R. P. Nr. 31058
vom 27. Mai 1884) soll das Gas möglichst fein vertheilt mit dem Wasser in Berührung
kommen. Zu diesem Zwecke wird das Gas durch fein durchlöcherte Platten a geführt, welche in den Wasserbehältern b liegen. Um die Adhäsion des Wassers in den Poren und
die Cohäsion desselben mit sich selbst zu vermindern, wird immer zwischen dem unter
und über der Platte liegenden Wasserraume ein diese beiden Spiegel trennender
Gasraum unter den Platten a dadurch gebildet, daſs die
Platten am Umfange einen Vorsprung c erhalten. Die bei
d zutretende Waschflüssigkeit geht dem Gase
entgegen und flieſst unten bei n ab. Die Waschhöhe wird
durch Hoch- und Niederschrauben der Rohre o in den die
Beobachtung erleichternden Glasgehäusen p geregelt.
Der Gaswaschapparat von E, Ledig
in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 31196 vom 23.
Oktober 1884) besteht nach Fig. 10 und 11 Taf. 33 aus
einer Anzahl über einander liegender Kammern, wobei in der untersten Kammer das Gas
bei G eintritt, während das Wasser oben bei w zuflieſst Jede Kammer steht mit der nächst oberen
durch die Gasrohre a und die Ueberlaufrohre b, bis zu deren Höhe jede Kammer mit Waschwasser
gefüllt ist, in Verbindung. In jeder Kammer schwangt über den beiden Gasrohren um
die Schneiden c ein oberhalb des Wasserspiegels
geschlossenes Blechgefäſs, welches durch seine oberen Begrenzungsflächen die
Kippgefäſse d bildet, unterhalb letzterer aber zu
beiden Seiten Systeme dünner, paralleler Bleche e
trägt, welche in geringem Abstande von einander zwischen den Seitenwandungen des
Blechgefäſses angebracht sind. Diese Blechgefäſse sind so gelagert, daſs stets das
eine System paralleler Bleche vollständig in den Wasserinhalt der Kammer eintaucht,
während das gegenüber stehende dem Gase freien Durchgang zwischen den angefeuchteten
Blechen bietet. Durch das fortwährend zulaufende Waschwasser wird nun mittels der
Ueberlaufrohre b stets das Kippgefäſs gefüllt, dessen
unterhalb gelegenes Blechsystem dem Gase freien Durchgang gestattet. Hierdurch
findet eine Schwerpunktsverlegung statt und das ganze Blechgefäſs kippt in seine
entgegengesetzte Lage über, so daſs nunmehr das Gas zwischen den neu angefeuchteten
Blechgefäſsen des gegenüber stehenden Systemes entweichen muſs, während die früher
oberhalb des Wasserspiegels befindlichen Bleche abgewaschen und gleichzeitig neu
angefeuchtet werden. Es findet sonach in jeder Kammer ein fortdauernder Wechsel in
der Stellung beider Blechsysteme und somit auch ein steter Wechsel des
Gasdurchganges statt.
Man kann die schwingenden Blechgefäſse der einzelnen Kammern auch durch die punktirt
angedeuteten Zugstangen f verbinden und das obere
Blechgefäſs durch äuſseren Antrieb in Schwingung versetzen, so daſs die schwingende
Bewegung von dem Zulaufe des Waschwassers nur unterstützt wird.
F.
Weck in Lilleshall, England (* D. R. P. Nr. 30416 vom 13. April 1884) will zum Waschen und Reinigen von Leuchtgas in Bewegung gesetzte
endlose Bänder verwenden, welche theilweise in die Waschflüssigkeit eintauchen. Die
auf den Bändern niedergeschlagenen festen Stoffe werden an passenden Stellen
abgebürstet. Der Apparat wird wegen Mangel an Einfachheit kaum Anwendung finden.
Noch weniger empfehlenswerth erscheint der Vorschlag von G.
Gregoire in Paris und Ch. Scharrer in
Straſsburg (* D. R. P. Nr. 30392 vom
15. Juli 1884), das zu reinigende Leuchtgas
durch Rohre zu leiten, welche von einer durch eine Kaltluftmaschine auf – 39° abgekühlten Lösung von Chlorcalcium oder
Chlormagnesium umgeben sind.
Nach F.
Pelzer in Dortmund (* D. R. P. Nr. 28790 vom 1. April 1884) wird das rohe
Leuchtgas durch einen Raum geleitet, in welchem von Wasser
durchflossene Kühlrohre aufgestellt sind. Von hier wird das Gas durch
Centrifugalgebläse angesaugt und durch mit Wasser berieselte Drahtgeflechte
gedrückt.
H. Pollack in Hamburg (* D. R. P. Zusatz Nr. 30124 vom
11. Mai 1884, vgl. 1884 253 * 467) will seinen Luftcarburirapparat dadurch für den Betrieb von
Gaskraftmaschinen vortheilhaft gestalten, daſs er in dem mit entfetteter
Wolle gefüllten Carburator B (Fig. 10 Taf. 34)
Rohrstücke f anbringt, welche in das Gasolin der
Vertiefungen g im Boden des Gefäſses eintauchen. Diese
Rohrstücke sind von Dochten durchzogen, welche das Gasolin aufsaugen und unter
Vermittelung von Löchern, mit denen die Röhren Wandungen etwa zur Hälfte ihrer Höhe
versehen sind, an die umschlieſsende Wollfüllung abgeben.
Um die möglichst gleichmäſsige Vertheilung des Gasolins zu erleichtern, endigt das
aus dem Behälter A das Gasolin dem Carburator
zuführende Rohr c innerhalb desselben in kreuz- oder
sternförmig angeordnete Mündungszweige v, welche das
Gasolin in Strahlen von entsprechender Anzahl in den Carburator treten lassen.
Zwischen dem Carburator und dem Rohre G, welches die
carburirte Luft dem Reiniger C zuführt, ist eine Kammer
M angeordnet, in welche über einander Bleche o gehängt sind, die als Anprallfläche für aufspritzende
Gasolintheilchen dienen.
Um zugleich zu verhindern, daſs Wollfasern in die Kammer M eindringen, ist dieselbe nach unten durch ein Sieb s abgeschlossen. In die das Gas seiner
Verwendungsstelle zuführende Leitung V ist eine Kammer
D eingeschaltet, welche die Aufgabe hat, einen
Gasvorrath anzusammeln, der beim Beginne des Betriebes des Motors in Wirksamkeit
treten soll. Ein an der Einmündung des Rohres V in die
Kammer D angebrachtes Rückschlagventil h verhütet ein Rücktreten von Gas aus der Maschine in
die Kammer.
In die Leitung L, welche dem Apparate die gepreſste Luft
zuführt, ist ein Zweiwegehahn r eingeschaltet, der je
nach seiner Stellung den Luftbehälter entweder mit dem Carburator unter Vermittelung
des Rohres L, oder mit der äuſseren Atmosphäre unter
Vermittelung einer entsprechenden Bohrung im Hahngehäuse r in Verbindung setzt. Auf diese Weise kann man beim Anlassen der
Maschine, indem man die Verbindung zwischen dem Gasometer und der Röhre L herstellt, die Luft zunächst aus dem Gasometer unter
Druck in den Carburator eintreten lassen und dann dieselbe, nachdem der Motor im
Gange ist, durch Umstellung des Hahnes r mittels der
Maschine unmittelbar in den Carburator einsaugen lassen.
P. Th.
Dubos in Paris (* D. R. P. Nr. 29632 vom 9. Juli 1884) legt bei seinem Apparate zum Carburiren von Luft das Hauptgewicht auf
die Verwendung zweimal im rechten Winkel umgebogener Rohre abc (vgl. Fig. 11 und 12 Taf. 34). Das Gasolin
bedeckt die den Schenkel c umschlieſsende Muffe d an der Welle e, welche
durch das Vorgelege f, g gedreht wird. Das gekröpfte
Rohr i ist mit Glycerin gefüllt und trägt in seinem
oberen Ende einen als Kolben ausgebildeten Schwimmer, der mit seiner Stange gegen
das obere Ende des Bremshebels h wirkt, dessen unteres
Ende wieder an die Achse des Rades f drückt. Der
Kolbenschwimmer bewegt sich je nach dem Drucke der in der Abtheilung p enthaltenen carburirten Luft in dem Rohre i hin und her. Das Gasolin flieſst durch das Rohr k zu, die Luft tritt durch das Ventil n ein, welches sich durch die angesaugte Luft nach
innen öffnet. Taucht nun der Rohrschenkel a in die
Flüssigkeit, so wird die im Rohre ab befindliche Luft
durch den Schenkel c in den durch die Scheidewand o abgetrennten Raum p
gedrückt und das erzeugte Gas entweicht durch Rohr l.
Wird im Raume p der Druck der carburirten Luft wegen zu
geringem Abfluſs zu hoch, so bewirkt die Bremsvorrichtung ih sofort eine Verminderung der Geschwindigkeit der Welle e und es wird eine geringere Menge carburirter Luft
erzeugt. Es kann sogar ein vollständiger Stillstand des Apparates durch die Bremse
herbeigeführt werden, wenn der Druck in p zu groſs
wird, ein Fall, der immer eintreten wird, wenn alle oder ein Theil der durch das
Rohr l gespeisten Brenner geschlossen werden.