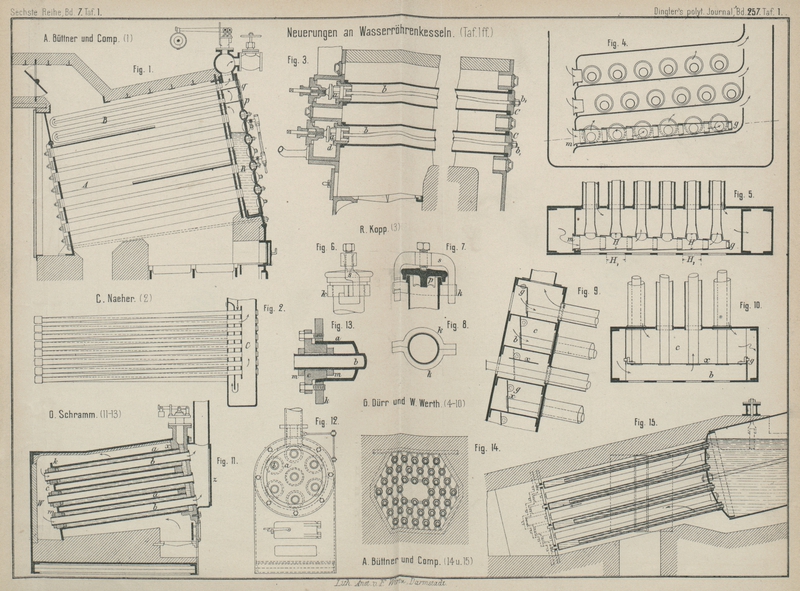| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 1 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.
Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 1.
(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes Bd.
256 S. 425.)
Ueber Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.
Kessel mit liegenden, von einer
Endkammer ausgehenden Röhren.
Die Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner und
Comp. in Uerdingen (* D. R. P. Nr. 28361 vom 29. Januar 1884) baut jetzt
auch solche Röhrenkessel, bei welchen sämmtliche Röhren von einer gemeinschaftlichen
vorderen Kammer ausgehen, hat dabei aber wieder das Hauptaugenmerk auf eine gute
Trocknung des Dampfes gerichtet. Zu diesem Zwecke sind, wie aus Fig. 1 Taf. 1 ersichtlich,
oberhalb der weiten, hinten geschlossenen Röhren A, in
welche Umlaufröhren eingelegt sind, engere gabelförmige Röhren B angeordnet und zwischen deren Mündungen in den
Wasserkasten R Querbleche q und p derart eingesetzt, daſs der Dampf
gezwungen wird, diese Röhren B in der angedeuteten
Weise zu durchströmen. Da dieselben eine ganz bedeutende Heizfläche haben, so ist
wohl anzunehmen, daſs das vom Dampfe mitgerissene Wasser in denselben vollständig
zur Verdampfung gelangt.
C. Naeher in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 30283 vom 13. Juni
1884) hat den ganzen Dampferzeuger (abgesehen vom Oberkessel) aus solchen
Gabelröhren, wie sie bei Fig. 1 zur Dampftrocknung
verwendet sind, hergestellt. Die beiden Schenkel jeder Röhre haben aber, wie in Fig. 2 Taf. 1
abgebildet ist, ungleiche Länge und sind in entgegengesetzter Richtung etwas
geneigt. Die längeren Schenkel ragen um ein Stück in die Wasserkammer C hinein und sind hier in einer Zwischenwand befestigt,
welche die Strömung des aufsteigenden Dampf- und Wassergemisches von der
absteigenden Strömung des vom Oberkessel kommenden Wassers scheidet. Eine zweite
Zwischenwand führt das Wasser zunächst nach unten, ehe es in die Röhren eintritt,
damit sich der mitgeführte Schlamm u.s.w. im unteren Theile von C ablagere und aus den Röhren möglichst fern gehalten
werde.
Eine französische Construction von H. Menay in Havre (*
D. R. P. Nr. 27623 vom 7. December 1883), hauptsächlich für Schiffe bestimmt, ist nach Armengaud's Publication
industrielle, 1885 Bd. 30 S. 193 nachstehend in Textfig. 1 bis 3 dargestellt. Auch hier
ist die vordere Kammer durch eine Zwischenwand in zwei Räume geschieden, welche
jedoch weder oben oder unten, noch seitlich, sondern nur durch den Oberkessel C hindurch mit einander in Verbindung stehen.
Fig. 1., Bd. 257, S. 2
Fig. 2., Bd. 257, S. 2
In der Zwischenwand e sind die
inneren Umlaufröhren O befestigt. Der in den Röhren M entwickelte Dampf gelangt aus der inneren Kammer
durch seitliche Kanäle e1 in den Oberkessel C, während das Wasser aus
diesem durch c in die vordere Kammer herabflieſst. Um
noch weitere Heizflächen zu gewinnen und die Wärmeverluste zu vermindern, sind die
Seitenwände Fig.
3. durch Wasserkammern ersetzt, welche durch verhältniſsmäſsig weite Rohre
D mit einander und durch einige sehr enge Röhren
b mit dem Oberkessel in Verbindung stehen. Durch
die Achse jedes Rohres D geht ein Ankerbolzen.
Fig. 3., Bd. 257, S. 2
Der kleine Behälter R soll als
Schlammsammler dienen. Der Dampf wird durch einen den Schornstein K umgebenden Ueberhitzer L
geleitet. Die vordere Wasserkammer ist aus zwei Platten E1 und E2 und einem guſseisernen Ringe E zusammengeschraubt (vgl. Textfig. 3) und
nur durch einen centralen kräftigen Bolzen verankert. Die schmiedeisernen Röhren M und O sind mittels
Bronzemuttern m und o
befestigt. Behufs Reinigung derselben wird die Vorderplatte E1 der Kammer abgeschraubt und die
Zwischenwand e mit den Innenröhren O herausgezogen.
Der dargestellte Kessel, für einen Dampfdruck von 5,5k/qc bestimmt, hat eine Heizfläche von
75qm. Der Oberkessel hat bei einem Durchmesser
von 900mm eine Blechdicke von 14mm; dieselbe Dicke haben auch die Wände der
Seitenkammern. Die unmittelbar über dem Roste liegenden Röhren D haben sogar bei 250mm Durchmesser eine Wandstärke von 19mm,
die übrigen von 10mm und die Röhren M bei 85mm innerem
Durchmesser eine Wandstärke von 5mm.
Bei einer anderen Ausführungsform sind die Seitenkammern durch lothrechte Rohre und
bei einer dritten durch wagerechte Rohre ersetzt. Die Kessel sind bereits mehrfach
seit längerer Zeit im Betriebe und sollen sich gut bewähren, namentlich wegen des
energischen Wasserumlaufes frei von Kesselstein bleiben, wenn der Schlamm etwa
wöchentlich 2 mal abgeblasen wird. In Deutschland werden derartige Formen wohl kaum
viel Anklang finden.
Die jedenfalls empfehlenswerthe vollständige Trennung der absteigenden, in die
Innenröhren führenden Strömung von der aufsteigenden des aus den äuſseren Röhren
kommenden Dampf- und Wassergemisches, welche schon von E.
Alban angestrebt wurdeSiehe E. Alban: Die Hochdruckdampfmaschine,
Rostock 1843. Die Scheidewände in den Kammern, auf die es hier ankommt,
finden sich D. p. J. 1849 112 * 1, woselbst über Alban's
Erfindungen berichtet wird, nickt angegeben., ist auch bei
mehreren anderen Constructionen durchgeführt. Wie Alban
haben G. Dürr und W. Werth
in Ratingen bei Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 27528 vom 18. September 1883) etwas
geneigte Querwände, aus ⊓ oder ⊤-Eisen bestehend, in der Kammer befestigt, welche einerseits einen Kanal
für die aufsteigende, andererseits einen solchen für die absteigende Strömung frei
lassen, wie in Fig.
4 und 5 Taf. 1 dargestellt ist. In das vordere etwas aufgetriebene Ende jedes
Innenrohres ist ein ⊤-förmiges Rohrstück eingesetzt und
sämmtliche ⊤-Stücke einer Reihe sind in einander
gesteckt, so daſs sie ein von m nach g hin allmählich enger werdendes und bei g geschlossenes Rohr bilden. Der Durchmesser H1 der
Reinigungsöffnungen in der vorderen Kammerwand ist etwas gröſser als die Breite H der ⊤-Rohre, so daſs diese
behufs Reinigung der Röhren leicht herausgenommen werden können. Zum Verschlusse der
hinteren Rohrenden dienen Kappen aus Stahlguſs (Fig. 6 bis 8), welche mit drei
Führungsstegen p versehen sind und auf den
kegelförmigen Rohrbord gepreſst werden. Der Bügel s
wird nicht unmittelbar hinter den Bord, sondern an zwei Rohrschellen k gehängt, so daſs der Druck auf den ganzen Umfang des
Bordes vertheilt wird.
Bei einer neueren einfacheren Anordnung von G. Dürr und
W. Werth (* D. R. P. Nr. 29087 vom 9. December
1883) ist die Kammer jeder Rohrschicht durch ein eingehängtes, um zwei Zapfen
drehbares Blech x (vgl. Fig. 9 und 10 Taf. 1) in zwei Räume
b und c geschieden, in
welchem Bleche die Innenröhren ruhen. Die Kammern b
sind rechts, die Kammern c links geschlossen. Um zu den
äuſeren Röhren zu gegelangen, werden die Innenröhren durch die Reinigungsöffnungen
zunächst herausgezogen und dann die Bleche x um die
Zapfen g in die wagerechte Lage gedreht.
Um einzelne Röhren auch während des Betriebes auswechseln zu können, will R. Kopp in Huttrop, Rheinprovinz (* D. R. P. Nr. 27359
vom 13. December 1883) die in Fig. 3 Taf. 1 abgebildete
Einrichtung benutzen. Das vordere Rohrende ist über den kegelförmigen, in die
Kammerwand eingehängten Stutzen d gezogen, welcher
zugleich den Sitz für ein Ventil a bildet. In den Steg
dieses Stutzens ist der Kopf einer Ankerschraube b
eingehängt, welche sämmtliche Theile einschlieſslich des Deckels C am hinteren Rohrende zusammenhält. Die Bolzen b sind wellenförmig gebogen, um eine etwas ungleiche
Ausdehnung der Röhren und Bolzen zu ermöglichen. Um eine Röhre auszuwechseln, hat
man hiernach nur nöthig, das betreffende Niederschraubventil a zu schlieſsen, die Mutter b1 zu lösen, nach Abnahme des Deckels das Rohr durch
die Hinterwand herauszuziehen, ein neues einzusetzen und nach Aufsetzen des Deckels
mittels der Mutter b1
fest einzupressen, worauf das Ventil a wieder geöffnet
werden kann.
Der in Fig. 11
und 12 Taf. 1
abgebildete Kessel von O. Schramm in Berlin (* D. R. P.
Nr. 31207 vom 2. August 1884) besteht aus einer geringeren Zahl ziemlich weiter
Röhren a, durch welche engere Heizröhren b hindurchgeführt sind. Am vorderen Ende werden die
Röhren a in die Hinterwand x der Wasserkammer eingeschraubt, während das hintere Ende in einem Bleche
k ruht. Die inneren Röhren b werden hinten mittels je eines Kegelstumpfes c, welcher zwischen zwei auf b
aufgeschraubten Muttern m gehalten wird, gegen die
äuſseren Röhren abgedichtet, wie aus Fig. 13 ersichtlich ist.
Die vorderen Enden der Innenröhren werden, nachdem hinten die Pfropfen c eingepreſst sind, in der Auſsenwand des Wasserkastens
umgebördelt. Um die Röhren herauszunehmen, hat man die hintere Wand W zu öffnen, die äuſseren Muttern m abzuschrauben und die Kegelstutzen loszuschrauben und
herauszuheben, worauf man die Röhren a herausschrauben
kann. Die Innenröhren können dann, nachdem sie durch einen Schlag auf das hintere
Ende gelöst sind, durch die Rauchkammerthür z
herausgezogen werden. Diesem wie dem vorbeschriebenen Kessel fehlen die Bedingungen
für einen geregelten Wasserumlauf.
Die schräge Gestalt und Lage – welche F. Rupert und C. Sulzberger (1883 248 *
107) einem Field'schen Kessel gegeben, um die schnelle
Zerstörung, namentlich des
Rohrbodens zu vermeiden – will die Rheinische
Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner und Comp. in Uerdingen (* D. R. P. Nr.
29393 vom 3. Februar 1884) für Kessel benutzen, welche hinter metallurgischen Oefen
aufgestellt werden. Dabei war hauptsächlich die Absicht maſsgebend, eine
verhältniſsmäſsig groſse Heizfläche, wie sie Röhrenkessel bieten, zu erlangen, ohne den Zug der Heizgase merklich zu beeinträchtigen.
Der Kessel ist schräg in den annähernd wagerecht streichenden Zugkanal
hineingesenkt, so daſs eine Richtungsänderung des Gasstromes vermieden ist. Um die
verhältniſsmäſsig langen Röhren am hinteren geschlossenen Ende zu unterstützen, sind
dieselben mit dünnen Zapfen in einem gegossenen, ebenen oder treppenförmigen Gitter
gelagert (vgl. Fig.
14 und 15 Taf. 1), dessen Stäbe einen bogenzweieckigen Querschnitt haben, mithin
den Heizgasen möglichst geringen Widerstand bieten.
(Schluſs folgt.)
Tafeln