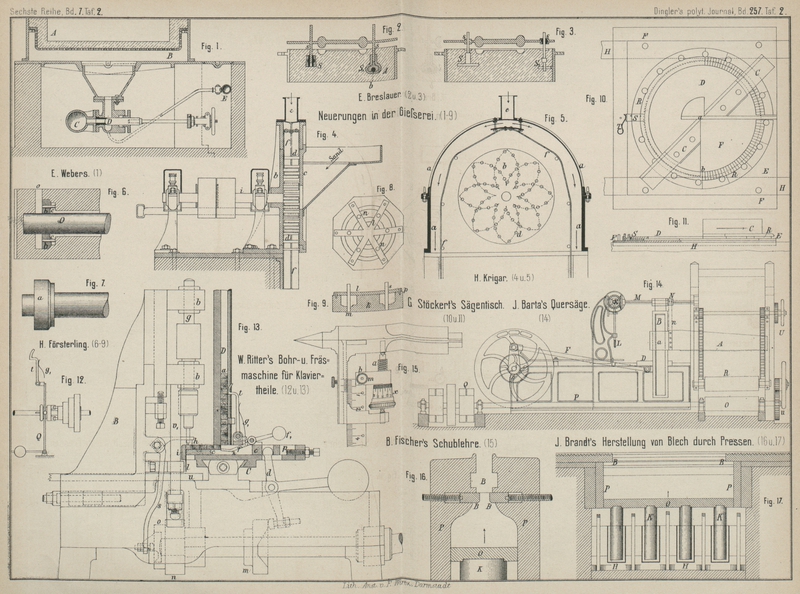| Titel: | W. Ritter's selbstthätige Bohr- und Fräsmaschine für Klaviertheile. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 12 |
| Download: | XML |
W. Ritter's selbstthätige Bohr- und Fräsmaschine für
Klaviertheile.
Mit Abbildungen auf Tafel
2.
Ritter's selbstthätige Bohr- und Fräsmaschine für
Klaviertheile.
Zum Bohren und Fräsen von Klaviertheilen (vgl. Lexow
1883 248 * 19) bringt W.
Ritter in Altona (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 30958 vom 10. August 1884) die in
Fig. 12
und 13 Taf. 2
dargestellte Maschine in Vorschlag. Die Bohr- bezieh. Frässpindel g wird mit ihren Docken b
in dem Gleitlager des Bockes B durch das Gestänge v1 von der unrunden
Scheibe n aus in der Achsenrichtung verschoben. Die in
dem Gestelle D aufgestapelten Klaviertheile gelangen
auf den von der Scheibe m mittels des Hebels d entsprechend in seinem Gleitlager bewegten Schieber
c. Wird dieser mittels des Hebels d bis zu der die Bewegung begrenzenden Stellschraube
p zurückgezogen, während eine kleine, den Schieber
durch einen Schlitz z durchdringende Sperrklinke f, welche auf dem Support C drehbar gelagert ist, die Klaviertheile a
hindert, mit zurück zu gehen, so wird aus dem Behälter D der ganze Satz in die Austiefung des Schiebers c herabsinken und ein frisches Stück in den Raum zwischen dem durch die
Klinke zurückgehaltenen Stücke und dem Ansätze des Schiebers c niederfallen. Die Klinke f wird durch die
Werkstücke in den Spalt
z niedergedrückt, bis ein neuer Theil den Schieber
c erreicht hat. Gleichzeitig wird das gebohrte
bezieh. gefräste Stück, da demselben der Boden c
entzogen ist, auf ein untergelegtes Brett u fallen,
welche Bewegung durch eine entsprechende Drehung des Drückers h gefördert wird. Inzwischen bewegt sich der Schieber
c wieder vorwärts und bringt ein neues Stück unter
den Bohrer; dasselbe wird durch den Schieber gegen die Widerlage i und durch den Drücker h
auf die Unterlage niedergepreſst. Die Klinke f nimmt
durch das Uebergewicht f1 die erste Stellung ein und legt sich hinter das frische Werkstück.
Seitlich werden die Stücke durch Anschläge, deren einer mit einer Feder versehen
ist, richtig geführt. Alle das Stück in seiner Lage unter dem Bohrer begrenzenden
Flächen können gegen façonnirte ausgewechselt werden, der Figur des betreffenden
Theiles entsprechend. Beim Vorgehen des Schiebers wird ein am Ende desselben
angebrachtes Stahlblech l den ganzen Satz fertiger
Arbeitstücke auf dem Brette um ein Stück weiter schieben, um dem nächsten Platz zu
machen.
Der Drücker h wird durch die Stange s von der Curvenscheibe o
bewegt. Die Scheiben m, n und o sitzen auf derselben Antriebwelle. Eine Klinke t lehnt sich gegen den Inhalt des Zuführungskastens D und fällt vor, sobald der Inhalt seinem Ende
entgegengeht, wodurch dann das Abstellen des Schiebers c bezieh. der Maschine bewirkt wird, was namentlich für den Fall von
Wichtigkeit ist, daſs ein Arbeiter eine Anzahl Maschinen bedient. Diese Abstellung
kann in der durch Fig. 12 angedeuteten Weise bewirkt werden, in welcher bei Drehung der
Klinke t nach links, welche durch Feder g1 sofort erfolgt,
sobald t keinen Widerhalt an den in D enthaltenen Werkstücken mehr findet, ein durch
Gewicht selbstthätig gemachter Ausrücker Q frei
wird.
Tafeln