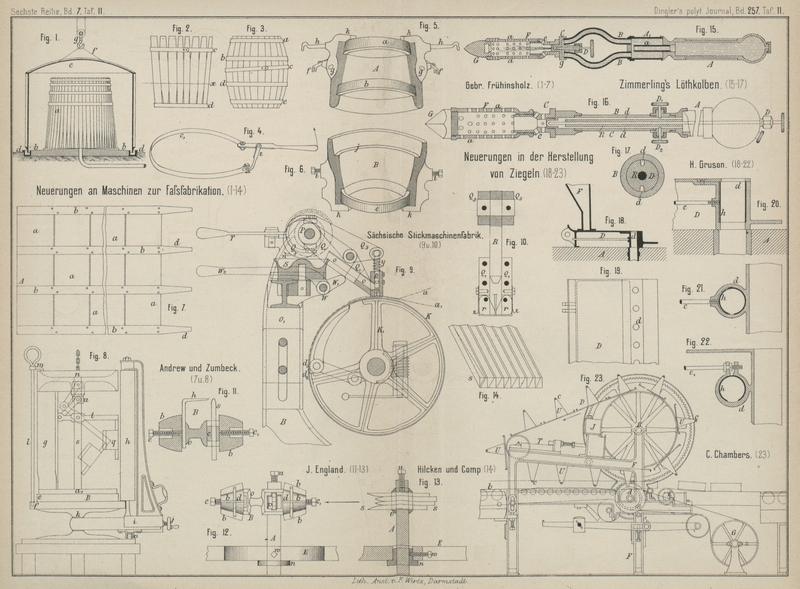| Titel: | Löthkolben mit flüssigem Heizstoff. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 135 |
| Download: | XML |
Löthkolben mit flüssigem Heizstoff.
Mit Abbildungen auf Tafel
11.
Zimmerling's Löthkolben mit flüssigem Heizstoff.
A. Zimmerling, J. Knoeppel und A. Pauly in Milwaukee (Oesterreichisch-Ungarisches Patent Kl. 49 vom 18.
März 1884) haben einen Löthkolben angegeben, welcher unmittelbar durch irgend einen
leicht flüchtigen Kohlenwasserstoff geheizt wird und so eingerichtet ist, daſs nach
Abschrauben des eigentlichen Kolbenkörpers der übrig bleibende, im Handgriffe den Brennstoff
enthaltende Löthkolbentheil auch ohne weiteres als Löthrohr verwendet werden
kann.
Der hohle Handgriff A (Fig. 15 Taf. 11) nimmt
den Brennstoff auf und ist durch ein Röhrchen a mit dem
Hohlräume A1 in
Verbindung, aus welchem der flüssige Brennstoff durch die Röhren B zu dem Heizbrenner gelangt; letzterer ist aus einem
Düsenstücke C und aus einem Niederschraubventile D zum Regeln der zu verbrennenden Brennstoffmenge
gebildet. Wenn mit dem Kolben gelöthet werden soll, so öffnet man das Ventil D ein wenig und erhitzt das Düsenstück C an irgend einer Flamme. Dadurch wird der Brennstoff
vergast, so daſs das Gas durch das Ventil D austritt
und sich entzündet. Die Flamme brennt dann in das durchlochte Rohr F am Löthkolben hinein, wobei sie durch die Oeffnungen
e mit der nöthigen Luft gespeist wird, während die
Verbrennungsproducte durch die Oeffnungen a entweichen,
bezieh. die Flamme aus letzteren herausbrennt. Hierdurch wird einerseits die im
Rohre F eingeschraubte Kolbenspitze G erhitzt, indem die Flamme das hintere Ende derselben
berührt, und auſserdem die Wärme des starkwandigen Rohres F durch Leitung auf die Kolbenspitze G
übertragen. Andererseits findet auch eine theilweise Uebertragung der Wärme von dem
Rohre F auf das Düsenstück C durch Leitung statt, was eine ununterbrochene Vergasung des als
Brennstoff dienenden Kohlenwasserstoffes und dadurch eine Speisung der Flamme mit
brennbarem Gase zur Folge hat.
Durch Schlieſsen des Ventiles D kann die weitere
Wärmezuführung an die Kolbenspitze sofort aufgehoben werden.
Bei der in Fig.
16 Taf. 11 dargestellten Abänderung dieses Löthkolbens reicht die Stange
des Niederschraubventiles D durch den ganzen Griff A und das Zuleitungsrohr B
hindurch. Dieses Rohr B birgt in sich das mit den
beiden Längskanälen d (vgl. Fig. 17) versehene
hölzerne, oder aus irgend einem anderen passenden Materiale hergestellte Rohr R. Die Durchlaſsweite dieser Kanäle kann durch die
Niederschraubventile D1
und D2 beliebig
geregelt werden. Für die Gröſse der hierbei auftretenden Gasentwickelung ist die
Einstellung der letztgenannten Ventile maſsgebend.
Soll z.B. eine starke Heizung erzielt werden, so öffnet man diese Ventile ganz, damit
das sich bildende Gas durch den einen Kanal in den Brennstoffraum zurücktreten und
neuen Brennstoff zur Vergasungsstelle pressen kann. Denselben Zweck haben übrigens
auch die beiden Zuleitungsrohre B bei dem Löthkolben
Fig. 15.
Soll dagegen die Erhitzung verringert werden, so schlieſst man das eine der Ventile
D1 oder D2, oder auch beide
gleichzeitig etwas.
Bei beiden beschriebenen Anordnungen wird die Löthkolbenspitze G abgeschraubt, sobald man den Apparat als Löthrohr
verwenden will. (Vgl. Arnold und Egers 1885 256 * 213.)
Tafeln