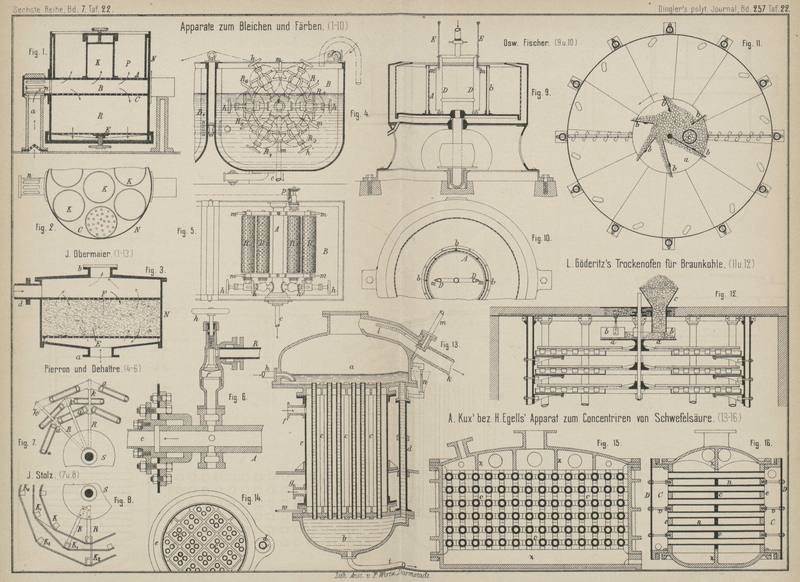| Titel: | Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u. dgl. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 319 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u.
dgl.
Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 22.
Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u. dgl.
Die früher (1884 253 * 126. 254
* 205) beschriebenen Apparate, in Welchen die zu färbenden, zu bleichenden oder zu
waschenden Faserstoffe in zusammengepreſster oder gespannter Lage dem kreisenden
Flüssigkeitsstrome ausgesetzt werden, haben sich rasch in die Praxis eingeführt und
weitere Ausbildungen erfahren.
Zur Erleichterung des Ein- und Auspackens der zu
behandelnden Stoffe hat Jul. Otto Obermaier in
Lambrecht (* D. R. P. Nr. 29345 vom 11. März 1884) seinen Apparat (vgl. 1884 253 *
126) in die Form Fig. 1 und 2 Taf. 22 gebracht, wie
sie besonders zum Färben von Kammzug und loser Wolle in Verwendung kommt. Ein cylindrischer
Kessel N ist durch einen doppelten Siebboden A und C in drei Räume
getheilt. Der mittlere kleinste Raum B erhält einen Rohransatz n, welcher zugleich einen der Zapfen bildet, mit
welchen der Kessel drehbar in einem Gestelle gelagert ist. In die äuſseren Räume R und P werden auf die
Siebböden die zu färbenden Stoffe gepackt und dieselben durch gelochte Deckel E mittels Schrauben fest zusammengedrückt. Beim Färben
von Kammzug werden die einzelnen Spulen in Töpfe K
gelegt und ebenso zusammengepreſst und mehrere solcher Töpfe neben einander in der
in Fig. 2
angedeuteten Weise auf dem Siebboden C befestigt, wozu
derselbe gleich entsprechend eingerichtet, d.h. nur an den von den Töpfen bedeckten
Stellen durchlocht ist. Die Farbflüssigkeit wird, nun durch eine Pumpe in dem hohlen
Gestelle a und durch den Rohransatz n in den Mittelraum B des
cylindrischen Kessels gepreſst und muſs von hier aus ihren Weg durch die Siebböden
und die zusammengedrückten Fasern nehmen, bis sie nach Durchdringung der Siebdeckel
in ihren Behälter zurückflieſst, um denselben Weg immer wiederholt zu machen. Beim
Ein- und Auspacken ist der Kessel leicht durch Drehung in eine entsprechende Lage zu
bringen.
Ein zweiter von Obermaier angegebener Apparat Fig. 3 Taf. 22
mit einem feststehenden Kessel hat nur einen Raum zur Aufnahme der Waare; doch gestattet
derselbe der Farbflüssigkeit, einen Weg nach zweierlei Richtungen zu nehmen, was für
ein gründliches und gleichmäſsiges Durchfärben nur vortheilhaft sein kann. Der mit
dem Siebboden F und dem die Stoffe zusammendrückenden
Siebdeckel E versehene, oben und unten geschlossene
Kessel N erhält an der einen Seite und in den beiden
Deckeln Rohransätze a, b und d. Wird der obere Ansatz b verschlossen und
die Farbflüssigkeit durch d in den Kessel gepreſst, so
nimmt dieselbe ihren Weg durch die Stoffe in der Richtung der ausgezogenen Pfeile.
Schlieſst man dagegen die Zuleitung d und drückt die
Flüssigkeit in dem Rohransatze a in den Kessel, so
nimmt sie bei geöffnetem Ansätze b ihren Weg in der
Richtung der punktirt angegebenen Pfeile.
An seiner Schleudermaschine zum Bleichen und Färben hat
Osw. Fischer in Göppersdorf (* D. R. P. Nr. 29702
vom 5. Juli 1884) eine verbesserte Einrichtung zur Einführung der Flüssigkeiten angebracht. Während bisher die Farb- oder
Bleichflüssigkeit im Inneren des Schleuderkessels durch ein doppeltes Siebrohr
ausströmte, ist jetzt ein doppeltes geschlitztes Rohr vorhanden. Die kleinen Löcher
des Siebrohres verstopften sich sehr leicht und ergaben dann eine ungleiche
Vertheilung der Flüssigkeit. Die Eintheilung des Schleuderkessels durch Siebwände
ist wieder aufgegeben und nur, wie aus Fig. 9 und 10 Taf. 22 hervorgeht,
das innere concentrische Sieb A beibehalten. In
dasselbe reichen die zwei zusammen aus einer Zuleitung gespeisten Rohre D, welche beide einen durch Ausbiegen der Wandung
zugeschärften Schlitz besitzen, durch den die Flüssigkeit in der ganzen Höhe
gleichmäſsig austritt. Zum Reinigen der Schlitze sind kleine, an den Stangen E befestigte Schieber m
vorhanden und kann
dadurch ein Ausstoſsen von Schmutz aus den Schlitzen auch während des Betriebes der
Maschine stattfinden. Weiter sind die Rohre D unten
durch mit Löchern versehene Muttern verschlossen, so daſs sich am Boden der Rohre
nicht so gut Schmutz ansetzen kann, oder solcher sich doch leicht durch Abschrauben
der Muttern entfernen läſst.
Weiterhin hat Osw. Fischer (vgl. * D. R. P. Nr. 31755
vom 6. December 1884) eine zur gleichmäſsigen Durchführung der Flüssigkeiten
nothwendige besondere Befestigung des inneren Siebcylinders
A angegeben. Wird dieser Siebcylinder durch wagerechte Reifen gestützt, so
entstehen diesen entsprechende Streifen in den behandelten Stoffen. Der
Siebcylinder, zu welchem am besten feines Drahtgewebe zu nehmen ist, wird daher von
senkrechten oder noch besser schrägen Streben b von
dreieckigem Querschnitte gestützt, die oben und unten mit ihren Enden an
durchlochten Winkeleisen reifen befestigt sind. Die Construction gestattet auch ein
leichtes Herausnehmen des ganzen Siebcylinders A zu
seiner Reinigung oder beim Einpacken der Waare.
Osw. Fischer benutzt die so eingerichteten
Schleudermaschinen hauptsächlich zum Bleichen und Bläuen von
Kötzern (Cops) und erzielt dabei ein gutes
gleichmäſsiges Product. Von Wichtigkeit bei der Benutzung der Schleudertrommel zum
Bleichen und Färben ist noch, wie sich herausgestellt hat, daſs man dieselbe
abwechselnd nach rechts und links umlaufen läſst.
Zur Ausführung des Rümmelin'schen Verfahrens zum Färben von Bändern und Gespinnsten aus Wolle hat J. Stolz in Roubaix (Erl. * D. R. P. Nr. 29089 vom 26.
Oktober 1883, abhängig von Nr. 27149, vgl. 1884 253 *
129) zwei neue Haspelconstructionen angegeben, um die Fasern in gespannter Lage
durch die Farbflüssigkeit zu führen. Bei dem Haspel für
Garnsträhne (Fig. 7 Taf. 22) sind auf
die an Scheiben S befestigten Stäbe R Klauen k geschoben, um
die Stäbe a zu fassen, um welche die Garnsträhne
geschlungen werden. – Beim zweiten Haspel Fig. 8 Taf. 22 wird das
Band oder Gespinnst auf die an den Stäben R sitzenden Stangen K
gewickelt und werden dann immer neue Stäbe mit Stangen K1 eingeschoben oder Stangen K2 durch besondere
Halter mit den Stäben R verbunden. Die Aufwickelung
wird fortlaufend um die neuen Stäbe vorgenommen, bis das Band oder Gespinnst ganz
aufgenommen ist, und zuletzt das Ende auf der letzten Stange befestigt. Bei beiden
Haspeln haucht bloſs eine Scheibe S mit Speichen
vorhanden zu sein und werden die Stäbe dann in der Mitte gefaſst.
Das von Farmer und Lalance angegebene Verfahren (vgl.
1884 254 * 205) ist ähnlich bei einer von Pierron und Dehaître in Paris (* D. R. P. Nr. 28942 vom
6. März 1884) angegebenen Maschine zum Kochen und Entfetten
von Geweben und Kettengarn angewendet. Es sind ebenfalls Siebcylinder
vorhanden, um welche das Gewebe geschlungen ist, und steht auch das Innere dieser
Siebcylinder mit einer Pumpe in Verbindung, welche beständig die Flüssigkeit ansaugt; doch liegt das
Gewebe nicht einfach um die Siebcylinder und bewegt sich mit diesen durch die
Flüssigkeit, sondern das Gewebe wird ganz um einen
Siebcylinder gewickelt, welcher eine längere Zeit in Ruhe in dem Färbe- oder
Entfettungsbade verbleibt, wobei beständig ein Durchsaugen der Flüssigkeit
stattfindet. Zur Zeitersparniſs sind, wie aus Fig. 4 und 5 Taf. 22 hervorgeht,
mehrere Siebcylinder R1
bis R6 sternförmig um
ein gemeinschaftlich mit denselben in Verbindung stehendes, an die Saugleitung c der Pumpe angeschlossenes Rohr A in einer Kufe B
angeordnet. Zwei dieser Siebcylinder stehen dabei immer auſserhalb der Flüssigkeit
und sind dieselben durch in dem entsprechenden Rohrarme sitzende Ventile f (vgl. Fig. 6 Taf. 22), welche
mittels der Handräder h zu bewegen sind, von dem
gemeinschaftlichen Rohre A abgeschlossen. Auf den einen
der auſser der Flüssigkeit befindlichen Siebcylinder B1 wird ein neues Gewebestück
aufgewickelt, während von dem daneben befindlichen Siebcylinder R6 das von der
Flüssigkeit in der Kufe B behandelte Gewebestück
abgezogen wird, um zu weiterer Behandlung auf den entsprechenden freien Cylinder
einer nächsten Kufe B1
aufgewickelt zu werden, oder in die Waschmaschine zu gelangen. Nach Bewerkstelligung
dieser beiden Arbeiten wird der ganze Stern mit den Siebcylindern durch Handhaben
m um 60° weiter gedreht, so daſs nun auf den leer
gewordenen Cylinder ein neues Gewebestück aufgewickelt werden kann, während man
gleichzeitig das aus dem Farbbade getretene Gewebestück wieder abzieht. Diese
Einrichtung gestattet, daſs an jeder Kufe beständig zwei Arbeiter mit dem Aufwickeln
beschäftigt sind, und jedes Gewebestück wird dabei während der dadurch bedingten
Dauer der Behandlung von dem kreisenden Flüssigkeitsstrome genügend durchdrungen.
Zum Aufwickeln des Gewebes wird der betreffende Cylinder von der Transmission aus
umgedreht, indem derselbe durch eine Kuppelung und Kegelräder mit der an den Kufen
entlang liegenden Triebwelle p verbunden wird.
Die Umwickelung des ganzen Gewebestückes um einen Siebcylinder, durch welchen die
Flüssigkeit angesaugt oder nach auſsen gepreſst wird, hat den Nachtheil, daſs die
inneren Umwickelungen mehr von dem Flüssigkeitsstrome durchdrungen werden als die
äuſseren, was eine ungleichmäſsige Durchfärbung oder Entfettung bedingt. Durch die
zu treffende Anordnung zweier Kufen B und B1 hinter einander mit
derselben Flüssigkeit kommt bei der beschriebenen Einrichtung das in der ersten Kufe
auſsen gelegene Gewebeende in der zweiten nach innen, so daſs eine Vertauschung der
inneren und äuſseren Umwickelungen stattfindet, durch welche der angegebene
Nachtheil nahezu aufgehoben werden dürfte. (Vgl. 1879 234
* 192. 1882 245 * 354. 1883 248 * 410.)
Tafeln