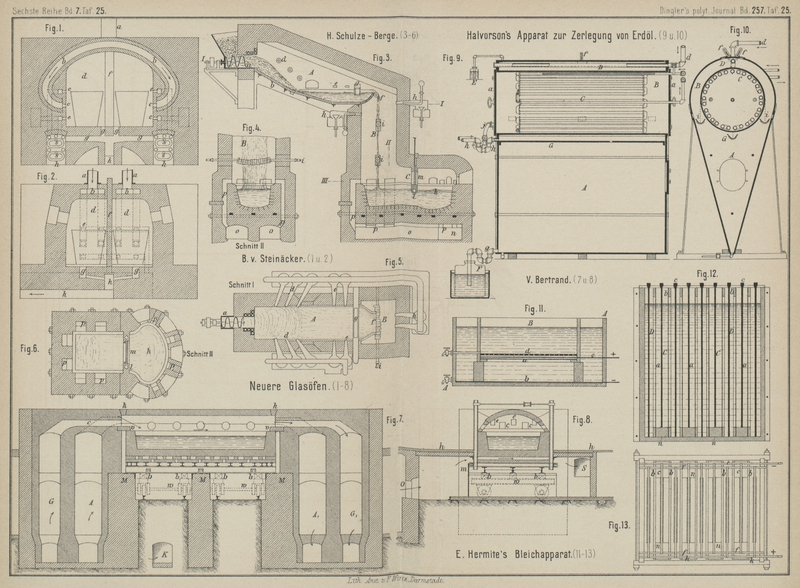| Titel: | Ueber Neuerungen an Glasöfen. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 369 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Glasöfen.
(Patentklasse 32. Vgl. Bericht Bd. 254 S. 27, Bd.
257 S. 154.)
Mit Abbildungen auf Tafel
25.
Ueber Neuerungen an Glasöfen.
B. v. Steinäcker in Lauban (* D. R. P. Nr. 29703 vom 27.
August 1883) will Glasöfen mit Wasser gas heizen, die
Luft nicht mittels Regeneratoren, sondern durch einen besonderen Heizapparat
vorwärmen und durch Einschalten von Zwischenwänden die Oefen in eine Anzahl Kammern
theilen, von denen nach Bedarf einzelne auſser Betrieb gesetzt werden können.
Das von a (Fig. 1 und 2 Taf. 25) zuströmende Gas
wird in den Kanälen. b vorgewärmt, bevor es zu den
Düsen c in den Ofenraum d
gelangt. Die in Rohren s vorgewärmte Luft tritt durch
Düsen e ein, die Verbrennungsgase entweichen durch
Kanäle g, h. Falls der Ofen als Kammerofen betrieben
werden soll, ist ein Theilungskreuz f vorhanden. Die
Tasche k dient zur Sammlung des überflieſsenden
Glases.
V. Bertrand in Sulzbach (* D. R. P. Nr. 29770 vom 7.
März 1884) empfiehlt eine bewegliche, vom Glasofen
unabhängige Wanne, welche durch Wagen w (Fig. 7 und 8 Taf. 25) zum Ofen
geführt wird. Auf denselben befinden sich 12 guſseiserne Sandbüchsen b als Unterlage für die 3 verbundenen ⌶-Eisen, auf welche die ganze Wanne mit Gewölbe
u.s.w. aufgebaut ist. Nachdem die Wanne an richtiger Stelle ist, läſst man den Sand
aus den Büchsen sich entleeren, wodurch die ganze Wanne sich auf die Mauern M aufsetzt und hierauf der entlastete Wagen leer zurück
auf die Baustelle gefahren werden kann. Die Wanne wird dann mit dem Ofen durch die
Schluſssteine k und die Platten v fest verbunden. Nach Entfernung des Wagens wird die Hüttensohle h wieder ersetzt, dann bei m ein Blech angebracht, um der kalten Luft, welche bei O eintritt und bei S in
den Kamin mündet, den durch die Pfeile angedeuteten Weg vorzuschreiben, wodurch die
Sohle der Wanne abgekühlt wird. Das Gas tritt durch G
und c, die Luft durch A
und e ein, die Verbrennungsgase entweichen durch die
beiden anderen Regeneratoren A1, G1 in den Fuchs K.
Nach B. Schulze-Berge in Pittsburg (* D. R. P. Nr. 31935
vom 1. April 1884) soll das durch einen Schacht aus dem Schmelzraume in die Wanne
fallende Glas der Wirkung heiſser Verbrennungsgase
ausgesetzt werden. Die mit Hilfe einer Schnecke a (Fig.
3 bis 6 Taf. 25) eingeführte Glasmischung wird auf dem geneigten Boden b der Wirkung mehrerer Gebläseflammen d ausgesetzt; das geschmolzene Glas sammelt sich in
einer tiefer gelegenen Mulde, wird hier nochmals dem Einflüsse von mehreren
Löthrohrflammen e ausgesetzt, so daſs etwa
mitgerissene, halb geschmolzene, schwimmende Theile der Mischung, die hier von einem
gekühlten Block g aufgehalten werden, vollends
einschmelzen und unter dem Kühlblock als flüssiges Glas hergehen, welches dann von
einem mit Wasser gekühlten Vorsprunge f in einen
Schacht B herunter durch die heiſsen Gase fällt, deren
Wirkung durch die Flamme h verstärkt werden kann. Da
das freie Fallen nur sehr kurze Zeit in Anspruch nimmt, so kann ein längeres
Verweilen des Glases in dem Schachte und eine verminderte Fallgeschwindigkeit
desselben durch Hindernisse hervorgerufen werden. Zu solchem Zwecke können mit
dünnem Platinblech überdeckte Brücken oder Bogen aus feuerfestem Materiale oder
gekühlte Röhren i in dem Schachte derart angebracht
werden, daſs das fallende Glas aufgehalten wird. Die Röhren können mit Stoffen
umkleidet sein, welche nicht nachtheilig auf das Glas einwirken, wie Platin oder
perlenartig angereihte Stücke möglichst von Asche und Eisen freier Kokes oder
ausgeglühte Stücke Anthracit.
Das in der Wanne C angesammelte Glas klärt sich in Folge
seiner hohen Temperatur und Dünnflüssigkeit leicht und kühlt sich langsam im
vorderen Theile k der Wanne, dem Arbeitsherde, welcher
durch eine gekühlte Zwischwand l mit dem heiſsen Glase
in Verbindung steht. In dem oberen Theile dieser Zwischenwand befindet sich ein
Schieber m, welcher, wenn aufgezogen, die
Verbrennungsgase auch in den Arbeitsherd treten läſst, um, wie bei kürzeren Arbeitspausen
nothwendig, das Glas auch in dem Vorherde warm erhalten zu können.
Die Verbrennungsgase ziehen aus dem Schmelzraume A durch
den Schacht B und dann durch seitliche Kanäle p an der Wanne herunter in die Gewölbe o und werden bei n zur
Gewinnung der darin enthaltenen Gase oder zur Benutzung in Regeneratoren oder
unmittelbar zum Kamine abgeführt.
Tafeln