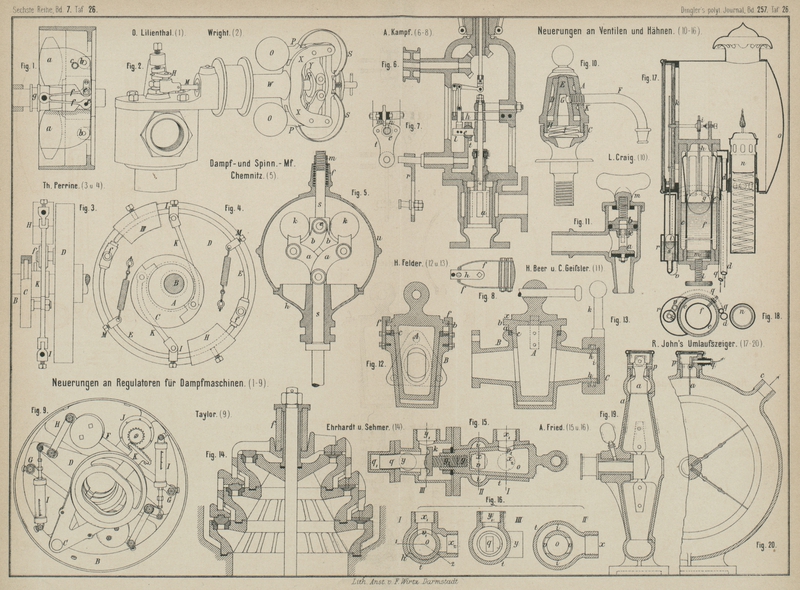| Titel: | Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen. |
| Autor: | K. H. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 389 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Regulatoren für
Dampfmaschinen.
(Patentklasse 60. Fortsetzung des Berichtes Bd.
256 S. 54.)
Mit Abbildungen auf Tafel
26.
Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen.
Direktwirkende Centrifugalregulatoren. O. Lilienthal in
Berlin verwendet neuerdings für seine Kleindampfmaschinen (vgl. 1882 245 * 315) einen
Regulator, der nicht mehr wie die in D. p. J. 1883 247 * 232 beschriebene Construction Hub und Voreilwinkel
des Expansionsexcenters verstellt, sondern unmittelbar auf
ein Sperrventil wirkt. Nach einer Notiz in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1885 * S. 31 sind die
Schwunggewichte a in der zur Arbeitsabgabe der
Dampfmaschine angeordneten Riemenscheibe angebracht, wie Fig. 1 Taf. 26 zeigt; die
Gewichte a schwingen um die Bolzen b, werden durch an den Zapfen c angreifende, beide Gewichte mit einander elastisch verbindende
Spiralfedern zusammengehalten und verschieben durch die bei e angreifenden Verbindungsstücke f den Muff
g, welcher auf das Drosselventil wirkt.
Durch Einfachheit zeichnet sich der von der Dampf- und
Spinnerei-Maschinenfabrik in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 31680 vom 30. Oktober
1884) angegebene Regulator aus. An die senkrechte Spindel sind die zwei
Schwungkugeln angelenkt und diese selbst sind wieder mittels zweier
Gelenkverbindungen an einen Träger gehängt, welcher die Spindel lose umfaſst und die
Unterstützung des als Hohlkugel den Mechanismus umschlieſsenden Belastungsgewichtes
bildet. Beim Auseinanderfliegen der Kugeln wird somit das Belastungsgewicht in die
Höhe gedrückt. Während in dieser Anordnung der
Regulator stark astatisch während seines ganzen Ausschlages ist, wird er bei der
zweiten, in der Patentschrift angegebenen Einrichtung pseudoastatisch. Diese
Anordnung ist nur eine Umkehrung der ersteren; die Hohlkugel hängt hier an den
Kugelarmen und wird somit, wenn die Auswärtsbewegung der Kugeln eintritt, gehoben.
Von der zweiten Construction ist im Praktischen
Maschinen-Constructeur, 1885 S. 246 eine wenig abgeänderte Form angegeben,
welche in Fig.
5 Taf. 26 wiedergegeben ist. Die Kugelarme a
sind mit der Hülse h, auf welcher die Hohlkugel u sitzt, zu beiden Seiten der in der Mitte
durchgehenden Spindel s gelenkig verbunden; die
Gelenkstücke b sind in dem festen Punkte e der Spindel s
aufgehängt. Die somit beim Ausfliegen der Kugeln eintretende Hebung des
Belastungsgewichtes u wird noch durch die Feder f gehemmt, deren durch die Mutter m zu bewerkstelligende Anspannung der gewünschten
Umlaufzahl der Dampfmaschine angepaſst werden kann. Die beschriebene
Regulatorconstruction ist einfach und hat wenige Gelenkpunkte, welche nur einseitig
belastet sind; die Reibung derselben wird also gering sein. Die Form des
Belastungsgewichtes schützt den Mechanismus vor Schmutz und bildet zugleich als
Einkapselung drehender Theile eine Schutzvorrichtung für den die Maschine bedienenden
Arbeiter. Die Spindel s wird nur auf Zug beansprucht,
indem das Drosselventil zugezogen, nicht wie gewöhnlich zugedrückt wird; es kann
somit kein Verbiegen der Ventilspindel und Zwängen derselben in der Stopfbüchse
eintreten. Das Drosselventil kann auch gleichzeitig als Absperrventil verwendet
werden, indem die Dampfabsperrung durch. Heben des Belastungsgewichtes mittels eines
Handrades ohne jeden Zwischenmechanismus geschehen kann. Somit erscheint der
Regulator zweckmäſsig zu sein.
Bei dem a. a. O. S. 38 beschriebenen Regulator von Wright liegt die Spindel W (Fig. 2 Taf. 26) wagerecht,
Die an einem Träger X aufgehängten Schwungkugeln O werden durch Blattfedern S, welche mit einem Ende sich gegen Nasen P
an den Kugelarmen, mit dem anderen sich gegen Nasen an dem Träger stützen, nach der
Spindel zu gepreſst. Die Kugelarme sind mit gegabelten Armen Y versehen, welche in den Regulatormuff N
greifen, dessen Bewegung durch die in der Hohlspindel W
verschiebbare Stange M mittels Kurbel H auf einen cylindrischen Drosselschieber übertragen
wird. Derselbe verengt bei wachsender Maschinengeschwindigkeit die schlitzförmigen
Durchgangsöffnungen für den Dampf. Die Empfindlichkeit des Regulators wird durch die
der Centrifugalkraft entgegenwirkenden Federn S
gemildert.
Centrifugalregulatoren, welche unmittelbar auf das den
Dampfschieber bewegende Excenter wirken und dessen Voreilungswinkel und
Excentricität verstellen, scheinen neuerdings mehr zur Anwendung zu gelangen, wie
aus der gröſseren Zahl hierfür angegebener Constructionen geschlossen werden kann
(vgl. 1884 251 * 194. 1885 256 * 12).
Eine neuere, im Scientific American, 1885 Bd. 52 S. 194
beschriebene Anordnung von Th. Perrine in Anna,
Nordamerika, ist in Fig. 3 und 4 Taf. 26 veranschaulicht.
Auf der Kurbelwelle B sitzt fest die excentrische
Scheibe A, welche lose von dem excentrischen Ringe C umschlossen wird; um letzteren faſst dann der Bügel
der den Dampfschieber bewegenden Excenterstange. Die Schwunggewichte H sitzen verstellbar an gebogenen Stangen E, welche um Drehzapfen f
beweglich an der auf der Kurbelwelle festsitzenden Scheibe D angebracht sind. Hinter den Gewichten tragen die Stangen E stellbare Köpfe I, an welche die Stangen K angehängt sind und so mit dem Excenterringe C in Verbindung stehen. Ferner greifen an den Stangen
E mittels der gleichfalls verstellbaren Köpfe M Spiralfedern an, welche an die Scheibe D gehängt sind und die Aufgabe haben, der
Centrifugalkraft der Schwunggewichte H entgegen zu wirken und damit die
Empfindlichkeit des Regulators zu mildern. Wenn nun bei der Drehung der Schwungrad
welle die Gewichte H nach auſsen sich bewegen, so tritt
eine entsprechende Drehung des Ringes C auf der Scheibe
A ein, wodurch Voreilwinkel und Excentricität für
die Schieberbewegung eine Veränderung erfahren.
Eine zweite solche Regulatoranordnung ist von Taylor in
Chambersburg, Nordamerika, a. a. O. S. 13 mitgetheilt. Hier ist wie bei dem Regulator von Meier (vgl. 1885 256 * 13)
das Excenter um einen Zapfen C am Kranze einer auf der
Kurbelwelle festsitzenden Seheibe B (Fig. 9 Taf. 26) drehbar.
Die Schwunggewichte sitzen an Stangen F, welche mit dem
einen Ende an die Zapfen G des Scheibenkranzes B gehängt und am anderen Ende durch Stangen H gelenkig mit den Armen D
verbunden sind, die eine Drehung des Excenters um seinen Aufhängepunkt entsprechend
der Auswärtsbewegung der Schwunggewichte bewirken. Der (Zentrifugalkraft wirken auch
hier in Kapseln I befindliche Federn entgegen, welche
beliebig angespannt werden können. Um eine ruhige Bewegung des Regulators zu
erzielen, ist noch ein Widerstand eingeschaltet, indem ein an dem Excenter
befestigter Zahnbogen K in ein kleines, in einem Arme
der Scheibe B drehbares Zahnrädchen greift. Auf der
Achse desselben sitzt ein Flügelrad, das von einem mit Oel gefüllten Gehäuse J umschlossen ist. Eine Verstellung des Excenters um
seinen Aufhängepunkt C bewirkt somit eine Drehung des
Flügelrades, welcher jedoch durch das Oel ein gewisser Widerstand entgegengesetzt
wird. Der Regulator soll sich auch für gröſsere Maschinen bewährt haben.
Es ist noch ein Regulator mit direkter Wirkung zu erwähnen, welcher von J. L. Heald in Crockett, Nordamerika (* D. R. P. Nr.
31607 vom 1. Oktober 1884) angegeben worden ist. Die Neuerungen desselben sind
unwesentlich. Die Schwungkugeln schwingen mit ihren Armen um Gelenke, welche am
Rande einer von der Maschine in Drehung um die Spindel versetzten Scheibe angeordnet
sind. Die Kugelarme stehen in schräger Richtung gegen einander und werden durch
Blattfedern gehalten, die als Bögen von den Kugeln aus nach ihren
Befestigungspunkten an der Scheibe laufen. Auf den Drehachsen der Kugelarme sitzen
Stangen, welche in den auf der Spindel befindlichen Muff fassen und somit die
Spindel und in Weiterem das an dieser befestigte, vollkommen entlastete Kolbenventil
bewegen.
Centrifugalregulatoren mit indirekter Uebertragung. F.
Knüttel in Barmen (* D. R. P. Nr. 30163 vom 19. Juli 1884, Zusatz zu Nr.
8197, vgl. 1880 235 * 8) hat seinen indirekten
Uebertrager dadurch verbessert, daſs die Scheiben des Reibungswendegetriebes nicht
mehr in den Kegelrädern hegen, sondern auſserhalb des Gehäuses angeordnet sind;
hierdurch können diese Scheiben beliebig groſs gemacht werden und der
Reibungsangriff leidet nicht mehr durch das abtropfende Schmieröl. Die neue
Anordnung der Reibungsräder bedingt die Trennung der Reibungskuppelung in zwei
Theile. Die Verschiebung der auf der Achse beweglichen Kuppelungshälften behufs
Eingriffes derselben geschieht nicht mehr Mittels eines Zahnbogens, sondern durch
eine Mutter, welche auf dem mit Gewinde versehenen Ende der Kuppelungswelle sitzt
und von dem Regulatormuffe verschoben wird. Bei der Einrückung einer Kuppelung wird die Welle
mitgenommen und ihr mit Gewinde versehenes Ende schraubt sich durch die nicht
drehbare Mutter, so daſs die Kuppelung wieder ausgerückt wird. Es erfolgt also eine
absetzende Verstellung des den Dampfzutritt beeinflussenden Organs, bis die
Normalgeschwindigkeit wieder erreicht ist.
Die von A. Kampf in Offenbach (* D. R. P. Nr. 31287 vom
19. Oktober 1884) angegebene Regulirungsvorrichtung ist eigentlich eine
Präcisionssteuerung und gehört zu derjenigen Gruppe derselben, bei welcher ein von
der Kurbelwelle bewegter Mitnehmer einen mit dem Expansionsventile verbundenen
Mitgänger so lange behufs Eröffnung dieses Ventiles führt, bis der Mitgänger
abschnappt und unter der Wirkung von Federn in seine erste Lage, bei welcher der
Dampfzutritt abgeschlossen ist, zurückkehrt. Die Kampf'sche Einrichtung benutzt zur Expansion einen Drehhahn a (Fig. 6 bis 8 Taf. 26). Ein auf dessen
Spindel lose sitzender Hebel l wird von der
Grundschieberbewegung aus mittels Gestänges und der Hebel r und t sowie des Kugellagers e in Schwingungen versetzt. Der Backen n (vgl. Fig. 7) legt sich dabei
gegen die Nase m, welche in dem auf der Hahnspindel
festsitzenden Hebel h geführt wird, bewegt dieselbe
vorwärts und dreht dadurch den Hahn a. Der Regulator verstellt die Nase m ihrer Höhenlage nach; gleitet dann n von m ab, so wird der
Hebel h durch die Federn f
(Fig. 8)
wieder zurück in seine Mittellage geschnellt, bei welcher a sich schlieſst. Die Länge des Eingriffes zwischen n und m, also die Dauer
des Dampfeintrittes hängt von der Stellung der Nase m
ab, so daſs also der Regulator unmittelbar die Füllung beeinfluſst. Wenngleich die
Anordnung nicht umständlich erscheint, so dürfte doch durch die gezwungene
Bewegungsübertragung von dem Gestänge auf den Hebel l
mittels des Kugellagers und die unsichere Einstellung des Hahnes durch die Federn
f diese Steuerung weniger zweckmäſsig sein als
zahlreiche andere solche Neuerungen.
Auch die in der Revue industrielle, 1885 * S. 123
mitgetheilte Regulirungsvorrichtung von G. Low
kennzeichnet sich als Präcisionssteuerung. Der Expansionshahn ist hier unmittelbar
auf dem Rücken des Grundschiebers angeordnet und wird seine Oeffnung wie sein
Abschluſs durch den Regulator herbeigeführt, wobei erstere stets bei gleicher
Stellung der Maschinenkurbel erfolgt. Auf der Achse des Expansionshahnes sitzt ein
Hebel, dessen Ende eine kleine Rolle trägt, welche zwischen zwei mit Vorsprüngen
versehenen Scheiben liegt. Die untere derselben sitzt fest auf der Achse eines
Schwungkugelregulators und stoſsen ihre Vorsprünge stets bei gleicher Stellung der
Maschinenkurbel gegen die kleine Rolle und drücken diese etwas aufwärts, wodurch die
Verdrehung der Hahnachse und damit die Oeffnung des Expansionshahnes erfolgt.
Letzterer bleibt dann in dieser Lage, bis die Rolle durch die Vorsprünge der oberen
Scheibe wieder abwärts gedrückt wird, und schlieſst sich hierdurch der Hahn wieder.
Die obere Scheibe sitzt nun auf einer hohlen Welle, welche mit einer schraubenförmigen
Rinne versehen ist, in welcher ein von den Schwungkugeln in seiner Höhenlage
beeinfluſster Stein greift. Wenn somit bei einer Steigerung der
Maschinengeschwindigkeit die Schwungkugeln nach auswärts fliegen, so heben sie den
Stein, dieser verschiebt sich in genannter Rinne und verursacht somit eine
Verdrehung der hohlen Welle und damit der oberen Scheibe, die dabei noch gleich
schnell wie die untere gedreht wird. Die besondere, durch den Regulator somit'
eintretende Verdrehung der oberen Scheibe bewirkt damit auch, daſs die Vorsprünge
früher oder bei langsamerem Gange später gegen die Rolle stoſsen, so daſs der
Abschluſs des Expansionshahnes entsprechend früher oder später erfolgt. Die
Vorrichtung ist einfach und soll nach genannter Quelle gut wirken.
Zu erwähnen ist noch, daſs der von C. v. Lüde angegebene
Regulator mit indirekter Uebertragung unter Benutzung
von Dampfkraft (vgl. 1884 251 * 201) nunmehr von Schäffer und Budenberg in Buckau ausgeführt wird. Der Praktische Maschinen-Constructeur, 1885 * S. 247 bringt
eine Beschreibung der in den Handel gebrachten Construction, welche sich jedoch von
der früher beschriebenen Anordnung nicht wesentlich unterscheidet.
Ein eigenthümlicher Regulator von Napier ist im Engineer,
1885 Bd. 59 S. 279 dargestellt. In einem mit Wasser gefüllten cylindrischen Gehäuse
sind zwei Scheiben angebracht, welche mit nach einer Seite vorstehenden gekrümmten
Schaufeln versehen sind. Beide Scheiben Werden mit den Schaufeln gegen einander
gesetzt, so daſs nur ein geringer Zwischenraum zwischen den beiderseitigen
Schaufelkanten bleibt. Da die Krümmung der Schaufeln bei beiden Scheiben gleichartig
ist, so kreuzen sich in der Zusammensetzung die
Schaufelflächen. Die eine Scheibe wird nun von der Kurbelwelle in rasche Drehung
versetzt und schleudert dann wie bei einer Centrifugalpumpe das Wasser von der Achse
gegen den Umfang. Die besondere Schaufelform jedoch verursacht dabei auch eine
Bewegung des Wassers gegen die zweite Schaufel; letztere würde nun gleich einer
Turbine durch das andrängende Wasser in Bewegung gesetzt werden, wenn sie nicht
dadurch gehemmt wäre, daſs auf der Achse des Rades eine Rolle sitzt, über welche
eine an einen belasteten Hebel angehängte Kette führt, die das Bestreben hat, das
Schaufelrad rückwärts zu drehen. Je nach der Maschinengeschwindigkeit wird die
Kraft, mit welcher das von dem stets sich drehenden Rade bewegte Wasser das zweite
Rad zu drehen sucht, gröſser oder geringer werden als der entgegengesetzt wirkende
Druck durch die belastete Kette; es wird sich demnach das zweite Schaufelrad
entsprechend etwas vor- bezieh. rückwärts bewegen. Diese von der
Maschinengeschwindigkeit abhängigen Bewegungen werden durch den erwähnten Hebel auf
die Drosselklappe übertragen.
Zum Schlusse sei auf eine von Prof. Salaba angegebene
graphische Methode der Berechnung von CentrifugalregulatorenVgl. Salaba; Die graphische Ausmittelung der
Centrifugalregulatoren mit maximaler Energie (Prag
1883). aufmerksam gemacht, welche ein Uebergangsglied
zwischen der statischen und dynamischen Regulatortheorie bildet. Salaba nimmt die mit der Zurücklegung eines gewissen
Weges von Seiten der Hülse verbundene Arbeitsleistung zum Ausgangspunkte seiner
Entwickelungen, deren graphische Behandlung einen klaren Einblick in den
Zusammenhang der wichtigen Bestimmungsgröſsen der Regulatoren gestattet.
K. H.
Tafeln