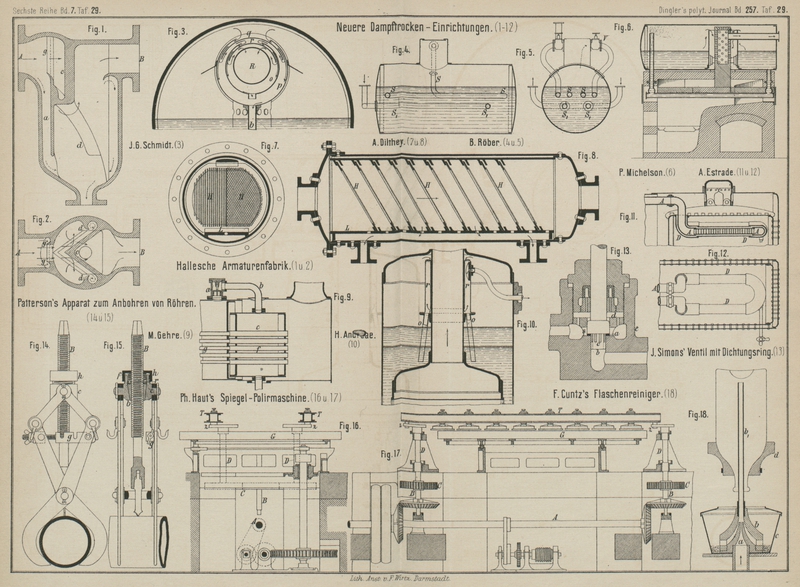| Titel: | Neuerungen an Dampftrocken-Einrichtungen. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 437 |
| Download: | XML |
Neuerungen an
Dampftrocken-Einrichtungen.
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 29.
Neuerungen an Dampftrocken-Einrichtungen.
Zur Trocknung des Dampfes auf mechanischem Wege sind
bekanntlich zahlreiche Einrichtungen vorgeschlagen worden, in welchen das Wasser
durch die Wirkung der Centrifugalkraft ausgeschleudert werden soll, indem der Dampf
zu einem gewundenen Wege mit möglichst starken Krümmungen gezwungen wird (vgl. 1881
241 * 335). Das Wasser wird jedoch im Dampfstrome in
Form von Bläschen schwebend erhalten und, so wenig als diese Bläschen im ruhenden
Dampfe zu Boden sinken, ebenso wenig werden dieselben aus einem Dampfstrome durch
die Centrifugalkraft nach der Richtung der Bahntangente ausgeschleudert werden.
Derartige Dampfentwässerer können daher auch immer nur das an den Wänden der Leitung
bezieh. der Gefäſse zu Tropfen verdichtete Wasser
ableiten, wozu eine passende Vertiefung als Sammelstelle, an welche sich das
Abfluſsrohr aufschliefst, ausreichen würde.
Nur in diesem Sinne wird auch der in Fig. 1 und 2 Taf. 29 dargestellte Dampfentwässerer der Halleschen
Maschinen- und Dampfkessel-Armaturen-Fabrik in Halle a. S. (* D. R. P. Nr.
29575 vom 22. Juni 1884) wirken. Dicht hinter der Eintrittstelle A ist ein Kanal a abwärts
geführt, welcher das bis zu dieser Stelle in der Leitung niedergeschlagene Wasser
abführt. Der Dampf strömt zwischen zwei hakenförmigen Rippen g hindurch, trifft dann gegen eine keilförmige Wand c, welche sich nach unten gabelt, und ist gezwungen,
unten durch diese Gabel hindurch und dann wieder nach aufwärts zu strömen, um bei
B zum Austritte zu gelangen. Rippen d und g sollen das
„ausgeschleuderte“ Wasser auffangen und nach unten ableiten. Die
eingebaute Wand c wird als guter Wärmeleiter stets
etwas Wärme nach auſsen abgeben und daher einen Theil der Wasserbläschen zu Tropfen
verdichten, wodurch aber der Dampfstrom nicht trockener wird.
J. G. Schmidt in Berlin (Erl. * D. R. P. Nr. 21204 vom
18. Juni 1882) hatte für seinen bekannten Gliederkessel (1881 242 * 400) den in Fig. 3 Taf. 29 im
Querschnitte abgebildeten Dampftrockner bestimmt. Das mit feinen Löchern versehene
Dampfsammelrohr B ist von zwei weiteren, oben offenen
Rohren o und p umgeben und
unter den Oeffnungen derselben sind Schalen q und r eingelegt, so daſs der Dampf zu dem durch Pfeile
angedeuteten Wege gezwungen wird. Das Wasser flieſst aus den tiefsten Stellen der
Rohre o und p durch das
Rohr b ab.
Ein anderes jedoch seltener verfolgtes Prinzip ist das der Durchleitung des Dampfes
durch Siebe, welches u.a. dem Dampftrockner von A. Dilthey in Rheydt (Erl. * D. R. P. Nr. 18803 vom 4.
September 1881) zu Grunde liegt. Wie Fig. 7 und 8 Taf. 29 ersehen läſst,
ist eine Anzahl paralleler Siebe H geneigt in eine
Erweiterung L des Dampfrohres eingestellt und bestehen dieselben aus 1,5
bis 6mm dicken Drähten, welche entweder sämmtlich
parallel sind oder sich kreuzen, jedenfalls aber alle steil abwärts gerichtet sind,
damit das Wasser leicht an denselben niederrieselt (vgl. M.
Schmidt 1885 256 564). Auch die Wirkung solcher
Siebe ist eine sehr fragliche, da von einem Absieben der Dampfbläschen wegen ihrer
Feinheit nicht die Rede sein kann und auch solche Siebe immer etwas Wärme an die
Gehäusewand und durch diese nach auſsen ableiten werden.
Eine wirkliche Dampftrocknung wird nur durch Zuführung von Wärme zu erreichen sein,
wie es bei den Dampfüberhitzern der Fall ist. Werden aber solche Ueberhitzer durch
die Feuergase geheizt, so sind dieselben immer einer schnellen Zerstörung
ausgesetzt, ganz besonders, wenn der Ueberhitzer unmittelbar im Feuer liegt. Eine
solche Anordnung haben z.B. Baron R. Sellière und L. M. Th. Riot in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 7150 vom
5. März 1879 und Zusatz * Nr. 11874 vom 31. März 1880) getroffen. In einiger Höhe
über dem Roste (bei Locomotiven und Locomobilen oben in der Feuerbüchse) ist ein
gewundenes eisernes Rohr von 40 bis 50mm
Durchmesser untergebracht, das einerseits mit dem Dampfdome, andererseits mit der
Maschine in Verbindung steht und durch welches beim gewöhnlichen Betriebe ein Theil
des Dampfes geleitet wird. Um das Rohr beim Anfeuern, wenn noch kein Dampf vorhanden
ist, und beim Stillstande der Maschine, wenn kein Dampf verbraucht wird, zu schonen,
ist dasselbe auch mit dem Wasserraume unter Einschaltung eines Absperrventiles
verbunden, so daſs es sich, wenn dieses Ventil geöffnet ist, mit Wasser füllt und
als Dampfentwickler dient. Trotz dieser Vorsichtsmaſsregel wird das Rohr bald
verbrannt sein.
A. Estrade in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 17811 vom 15.
Oktober 1881) hat das in ∪-Form durch die Feuerbüchse geführte Dampfrohr A (Fig. 11 und 12 Taf. 29),
um es zu schützen, mit einem etwas weiteren Rohre D
umgeben, welches frei in den Raum über der Feuerbüchse mündet, also immer mit Wasser
gefüllt sein wird. Ein Verbrennen des Dampfrohres ist hier wohl ausgeschlossen,
ebenso aber auch eine Trocknung und Ueberhitzung des Dampfes, da das Wasser doch nur
unmerklich wärmer sein kann als der Dampf desselben Kessels. In das
Ueberhitzungsrohr A ist ferner noch eine gröſsere
Anzahl durchlöcherter Scheiben eingesetzt, welche die Wassertropfen zurückhalten
sollen. Dieselben können allerdings insofern zur Trocknung des Dampfes beitragen,
als sie eine starke Drosselung desselben bewirken werden und der gedrosselte Dampf
dann noch Wärme aus dem Wasser aufnehmen kann. Beabsichtigt scheint aber hier die
Drosselung nicht zu sein.
Das letztere ist der Fall bei einer Einrichtung von B.
Röber in Dresden (* D. R. P. Nr. 26534 vom 31. Mai 1883), bei welcher
gleichfalls der Ueberhitzer, als Schlangenrohr S (vgl.
Fig. 4 und
5 Taf. 29)
oder in beliebiger anderer Form ausgeführt, im Wasserraume des Kessels untergebracht
ist. Vor seinem
Eintritte in den Ueberhitzer S soll der Dampf unter
Umständen durch einen sogen. Druckregulator – bei V –
gedrosselt werden. Eine Trocknung bezieh. Ueberhitzung ist dabei jedenfalls zu
erreichen; ob sie aber in Verbindung mit der Drosselung einen Vortheil ergibt, muſs
dahingestellt bleiben. Wichtiger ist wohl der weitere Vorschlag Röber's, einen derartigen im Kesselwasser liegenden
Ueberhitzer S1 bei Compoundmaschinen zur Heizung des vom kleinen nach dem
groſsen Cylinder strömenden Dampfes zu benutzen. Zweckmäſsig könnte dies natürlich
nur bei Maschinen sein, welche sich in nächster Nähe des Kessels befinden, z.B. bei
Compoundlocomotiven.
P. Michelson in St. Petersburg (Erl. * D. R. P. Nr.
26000 vom 11. Juli 1883) hat vorgeschlagen, namentlich bei Wasserröhrenkesseln im
Feuerraume oder in den Feuerzügen eine Metallmasse (z.B. Guſseisen) oder eine
Erzmasse (z.B. Raseneisenstein) anzubringen, welche sich, wie aus Fig. 6 Taf. 29 zu
entnehmen ist, durch die Wand des Dampfsammlers hindurch, ohne mit Wasser in
Berührung zu kommen, als Hohlkörper in den Dampfraum fortsetzt, und den Dampf durch
diesen Hohlkörper hindurchzuleiten. Der Metallblock wird allerdings je nach der
Gröſse seiner im Feuerraume liegenden Oberfläche eine gröſsere oder geringere
Wärmemenge an den Dampf überleiten, die praktische Ausführung jedoch einige
Schwierigkeiten bieten.
Von H. Andreae in Mannheim (* D. R. P. Nr. 24221 vom 17.
März 1883) rührt die in Fig. 10 Taf. 29
dargestellte Vorrichtung her, welche für Vertikalkessel mit durch den Dampfraum
geführtem Rauchrohre bestimmt ist. Auf einem an das Rauchrohr angenieteten
Winkelringe ist ein Blechcylinder befestigt, an welchen sich oben ein zweiter
engerer Blechcylinder schlieſst, der zwischen sich und dem Rauchrohre nur einen sehr
engen Zwischenraum läſst. Der Querschnitt dieses Ringspaltes soll doppelt so groſs
als der Querschnitt des Ausströmrohres sein. Diesen engen Raum muſs der Dampf von
oben nach unten durchströmen, um in den Raum r zwischen
den Blechmänteln zu gelangen, aus welchem er oben entnommen wird. Zwei Röhren o leiten das etwa nach r
mitgerissene Wasser nach unten ab. Die beiden Cylinder, wenigstens der innere,
sollen aus Kupferblech gefertigt werden. So lange der enge Ringraum nicht verstopft
ist, wird die Vorrichtung recht wirksam sein.
Die Heizung des Dampfes durch die schon stark gekühlten abziehenden Heizgase ist zwar nicht so wirkungsvoll wie die durch die
frischen Gase, gewährleistet dagegen eine längere Dauer des Ueberhitzers. Dieselbe
ist auch bei dem in Fig. 9 Taf. 29 abgebildeten Ueberhitzer von M.
Gehre in Cassel (* D. R. P. Nr. 27734 vom 9. December 1883) benutzt. In die
etwas verlängerte Rauchkammer eines Locomotivkessels ist eine Trommel c eingelegt, welche von Heizröhren f durchzogen wird. Diese Röhren haben eine solche Weite
und sind so angeordnet, daſs sie über die etwas vorspringenden Enden der
Kesselröhren g geschoben werden können, also eine Fortsetzung derselben
bilden. Ein Rohr b leitet den Dampf aus dem Kessel in
die Trommel c ein, aus welcher er im tiefsten Punkte
entnommen wird. Zweckmäſsiger wäre es wohl, wenn das Rohr b in c abwärts geführt und der Dampf oben
entnommen würde. Das Rückschlagventil a verhindert ein
Rückströmen des Dampfes und wird sich jedesmal bei einer Stauung desselben in Folge
der Absperrung an der Maschine schlieſsen.
Bei solchen durch die (frischen oder abziehenden) Feuergase geheizten Ueberhitzern
kann man die Frage aufwerfen, ob es nicht vortheilhafter sein würde, die Heizfläche
des Ueberhitzers als wasserbespülte Kesselheizfläche zu benutzen, im letzten Falle
(vgl. Fig. 8)
z.B. den eigentlichen Kessel um die Länge des Ueberhitzers zu verlängern, wodurch an
der Länge der ganzen Locomotive, am Feuerzuge u.s.w. nichts geändert würde.
Jedenfalls würde doch an das Wasser eine gröſsere Wärmemenge abgegeben als an den
feuchten oder gar an den trockenen Dampf, also auch mehr Wasser verdampft werden,
als mit dem Dampfe in den Ueberhitzer gelangt. Auſserdem erfordert bekanntlich der
trockene bezieh. überhitzte Dampf eine viel sorgfältigere Schmierung von Kolben und
Schieber der Maschine, wenn diese Theile sich nicht schnell abnutzen sollen. Sind
doch sogar Vorschläge gemacht (vgl. Lüde 1882 246 * 208), bei Locomotiven eine gewisse Dampfmenge
fortdauernd niederzuschlagen, um mit dem Dampfwasser die Schieber ausgiebig zu
schmieren. Im Allgemeinen wird daher die Anwendung besonderer Vorrichtungen zur
Trocknung bezieh. Ueberhitzung des Dampfes kaum zweckmäſsig sein. Hierfür spricht
auch der Umstand, daſs man auf Dampfschiffen, wo früher in der Regel Ueberhitzer
benutzt wurden, von der Anwendung derselben jetzt zurückgekommen ist.
Tafeln