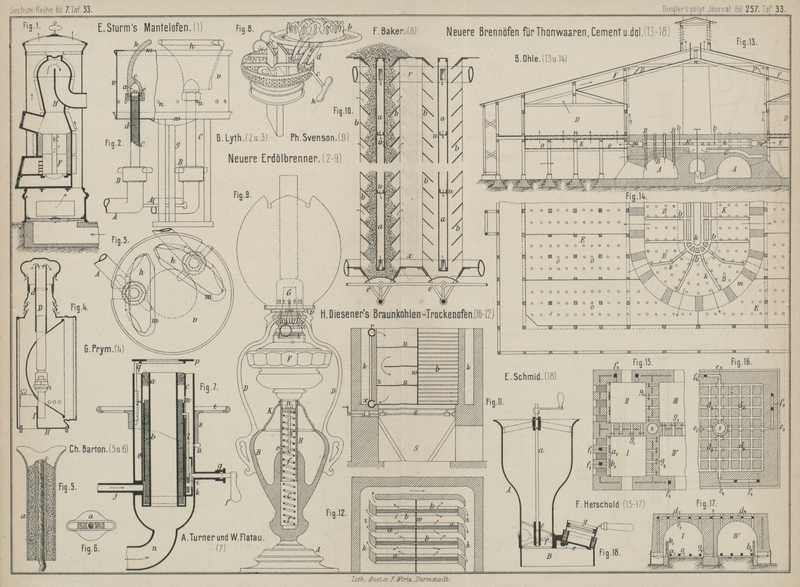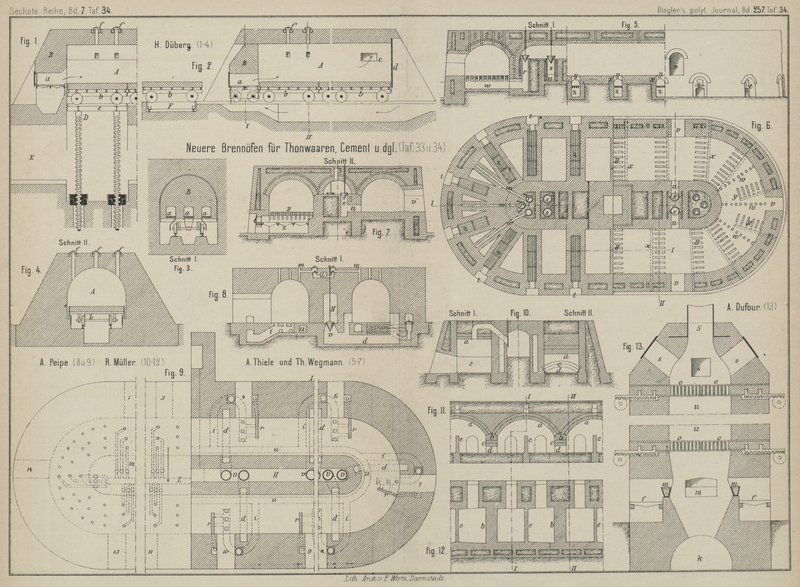| Titel: | Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und Cement. |
| Fundstelle: | Band 257, Jahrgang 1885, S. 512 |
| Download: | XML |
Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und
Cement.
(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes Bd.
254 S. 337).
Mit Abbildungen auf Tafel
33 und 34.
Oefen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und Cement.
B. N. Ohle in Hamburg (* D. R. P. Nr. 31927 vom 14.
Oktober 1884) legt bei seinem mit Trockeneinrichtung
versehenen Brennofen über die Ofenkammern A (Fig. 13 und
14 Taf.
33) einen von senkrechten Röhren B
durchzogenen Kanal K. Ein Theil der senkrechten Röhren ist durch
wagerechte Rohre k verbunden. Durch das Ventil b kann die Verbindung jeder Ofenkammer von den Röhren
abgesperrt werden. Unmittelbar neben und oberhalb dieser Heizkammer K befinden sich die von einander unabhängigen
Trockenkammern D und unter derselben, in gleicher Höhe
mit der Heizkammer, der Raum E als Sammelraum für die
warme Luft. Die frische Luft tritt durch Kanäle C in
die Heizkammer K, wird hier durch die Rohre B und k erwärmt, tritt bei
geöffneter Klappe m in die Wärmekammern E, durchdringt die Decke n, zieht aufwärts steigend durch die Trockenkammern D und entweicht durch die Abführungsschächte F ins Freie.
Nach Bedarf kann die warme Luft vor Eintritt in die Trockenkammern in den
Wärmekammern noch mit frischer Luft, welche durch die Oeffnungen o zugelassen wird, vermischt werden. Jede Trockenkammer
D hat ihren besonderen, durch die Klappe p stellbaren Abführungsschacht F. Es kann daher jede Kammer beliebig und unabhängig mit mehr oder weniger
Zug, mit mehr oder weniger Wärmegraden arbeiten. (Vgl. E.
Hoffmann 1885 255 * 346).
E. Schmid in Zürich (* D. R. P. Nr. 29692 vom 17. Mai
1884) verwendet als Beschickungsvorrichtung der
Ziegelöfen mit Brennstoff einen Fülltrichter A (Fig. 18 Taf.
33), welcher in dem auf dem Ofen stehenden Aufsatze B
befestigt wird. Die Achse a trägt zwei schiefe Flächen
c, durch deren Drehung die Gröſse der Beschickung
geregelt wird. Wird der mit dem Deckel e verbundene
Hebel f gehoben, so kann man durch die Glimmerscheibe
g das Feuer beobachten.
Der Ofen zum Brennen von Thonwaaren mit Einrichtung, den
Weg der Feuergase in den Kammern umzukehren, von F. H.
Hetschold in Nippes (* D. R. P. Nr. 28429 vom 3. Februar 1884) besteht, wie
Fig. 15
bis 17 Taf.
33 zeigen, aus 4 Kammern I bis IV. Wenn die Feuerungen der Kammer I brennen, so
streichen die Feuergase zunächst durch diese Kammer, treten dann in die Kammer II
und aus letzterer in den Kamin; die Kammer III ist während dessen beschickt, die
Kammer IV wird entleert. Nachdem die Kammer I fertig gebrannt ist, werden deren
Feuerungen ausgezogen und die Feuerungen der Kammer II in Gang gesetzt. Die
Feuergase gehen dann durch diese in die Kammer III und weiter in den Kamin, während
zur Abkühlung der fertigen Steine die Verbindung der Kammer I mit den übrigen
unterbrochen wird.
Angenommen, die Feuerungen der Kammer I brennen; dann treten
zuerst die Feuergase durch die unteren Oeffnungen a1 der Feuerwand b1, breiten sich am Boden der Kammer aus und steigen
von hier in die Höhe nach der Gewölbedecke, gehen durch die runden Oeffnungen c1 der letzteren in die
Kanäle d1 aus diesen in
die Kanäle d2 über der
Kammer II, durch das Gewölbe in diese Kammer, welche sie von oben nach unten
durchziehen und an deren Boden sie in die Kanäle f2 treten. Durch diese Kanäle werden die Feuergase
senkrecht in die Höhe, dann in den Mittelkanal e2 und aus diesem in den Kamin s geführt. Um den Feuergasen den vorbezeichneten Weg
anzuweisen, müssen die
Schieber der Kanäle d1
und d2 da, wo diese in
den Mittelkanal e1
münden, ferner der Schieber des Kanales f2 am Mittelkanale e2 und der Schieber des Mittelkanales e2 am Kamine geöffnet,
alle anderen Schieber aber geschlossen sein.
Nachdem die Feuergase eine gewisse Zeit lang in der beschriebenen
Richtung gegangen sind und dabei den Inhalt der Kammer I am Boden am stärksten, nach
oben schwächer, den Inhalt der Kammer II dagegen von oben nach unten erwärmt haben,
wird der Weg der Feuergase umgekehrt, so daſs sie in der Kammer I sich von der Decke
zum Boden, in der Kammer II vom Boden zur Decke bewegen. Zu dem Zwecke werden die
Oeffnungen a1 der
Feuerwand b1 vom
Heizerstande aus mit Asche und Schlacke verschlossen. Dadurch werden die Feuergase
gezwungen, an der Wand b1 in die Höhe und bis zur
Decke zu steigen. Die vorhin offenen Schieber der Kanäle d1 sind geschlossen, dagegen die Chamotteschieber der Verbindungskanäle g1 zwischen den Kammern
I und II geöffnet worden. Es gehen deshalb die Feuergase von der Decke nach unten
und treten durch die Kanäle g1 in die Kammer II am
Boden ein; in letzterer Kammer steigen sie in die Höhe, gelangen durch die
Oeffnungen im Gewölbe in das Kanalsystem d2 und durch die geöffneten Schieber in den
Mittelkanal e1 oder
auch e2 und in den
Kamin. Auch können die Feuergase aus den Kanälen d2 durch beide Mittelkanäle e1 und e2 zugleich in den Kamin geführt werden, wodurch eine
bessere Vertheilung der Wärme in der Kammer II erreicht wird.
H. Düberg in Berlin (* D. R. P. Nr. 29691 vom 4. Mai
1884) verwendet zum Brennen von Thonwaaren eine lang gestreckte Brennkammer A (Fig.
2 bis 4 Taf. 34), deren Sohle aus einer Reihe von Wagen b besteht. In der Stirnwand B befinden sich 3
Feuerungen a, während der Kanal c zum Schornsteine führt. Schaulöcher f
dienen zur Beobachtung des Feuers.
Nachdem die Wagen mit zu brennender Waare besetzt und in den Ofen eingeschoben worden
sind, wird die Thür bezieh. der Schieber d geschlossen
und Feuer auf den Feuerungen a in der Stirnwand B angezündet. Sobald die Waare auf dem der Stirnwand
B zunächst stehenden Wagen b gar gebrannt ist, wird die Stirnwand mit den Feuerungen mittels einer
vor dem Ofen aufgestellten Winde vorgezogen, desgleichen auch der erste Wagen mit
der gar gebrannten Waare; letzterer wird mittels der Schiebebühne F auf ein Nebengeleise gebracht und die Stirnwand B wieder in ihre vorige Stellung zurückgeschoben.
Demnächst werden die im Ofen zurückgebliebenen Wagen b
mit theilweise gebrannter Waare um eine Wagenlänge vorgeschoben, so daſs der bis
dahin an zweiter Stelle stehende Wagen jetzt die erste Stelle einnimmt, der dritte
Wagen die Stelle des zweiten u.s.w. Der letzte Platz wird dadurch frei und durch
einen inzwischen mit frischer Waare besetzten Wagen ausgefüllt. Die Thür d wird dann wieder geschlossen und das Feuern in der
Stirnwand B fortgesetzt.
Bei feststehender Stirnwand B (Fig. 1 Taf. 34) wird der
derselben zunächst stehende Wagen b, sobald die darauf
befindliche Waare gar gebrannt ist, mittels der Vorrichtung D in den Tunnel E hinabgelassen, wo er zur
Seite geschoben und entladen wird. Das Geleisestück e
wird dann mit Hilfe der Vorrichtung D wieder
emporgehoben, die Wagen im Ofen werden um eine Wagenlänge vorgeschoben und der
letzte derselben wird durch einen mit frischer Waare beladenen Wagen ersetzt.
Die in den gebrannten Steinen aufgespeicherte Wärme wird hier also nicht verwerthet
(vgl. Bock 1875 216 *
200).
A. Thiele und Th. Wegmann
in Crefeld (* D. R. P. Nr. 30306 vom 20. Juli 1884) verwenden zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und Cement einen Flammofen, dessen Roste z
(Fig. 5
bis 7 Taf. 34)
unter der Ofensohle liegen und mit schlitzartig durchbrochenen Gewölben y versehen sind. Neben denselben sind im Mauerwerke
Kanäle x ausgespart, deren Mündungen nach den Schlitzen
höher liegen als die glühenden Kohlenschichten. Nach jedesmaliger Beschickung der
Roste werden die Schieber dieser Kanäle geöffnet, so daſs von auſsen Luft eintreten
kann. Beim Einsetzen der Ziegel durch die Thür v werden
auf der Ofensohle Feuerkanäle ausgespart, welche in Verbindung mit den Schlitzen y stehen. Von diesen Kanälen aus steigt die Glut in die
Höhe, wird an der den Feuerthüren t gegenüber liegenden
Langseite durch die auf der Ofensohle liegenden Oeffnungen u den Abzuglocken s und durch diese dem
gemeinschaftlichen Kanäle und endlich dem Kamine zugeführt. Um in den runden Köpfen
des Ofens das Feuer auch an den äuſseren Umfang zu halten, ist hier der Abzug der
Feuergase so eingerichtet, daſs er durch die schlitzartig überwölbten Kanäle w in der ganzen Breite des Ofens gleichmäſsig unter die
Ofensohle gehen und dann erst in die Glocken r, welche
mit den Kanälen w in Verbindung stehen, treten
kann.
Bei dem Ziegelbrennofen von A.
Peipe in Haynau, Schlesien (* D. R. P. Nr. 30635 vom 1. Mai 1884) liegt
unter der Herdsohle rund um den Rauchkanal H (Fig. 8 und 9 Taf. 34) ein
Kanal u; von diesem zweigt sich bei jeder Brennkammer
ein Kanal i ab; in Fig. 8 deutet ein Pfeil
an, wie der Zug vom Kanal u durch i wieder nach dem Ofen führt. Der Kanal u mit den Kanälen i bildet
ein Schmauchsystem, durch welches nach Belieben heiſse Luft immer von der zuletzt
abgebrannten Kammer nach der zu schmauchenden Kammer geführt werden kann. Zugleich
bildet aber auch der Rost r bei jeder Kammer eine
Schmaucheinrichtung, indem er beim Schmauchen einer jeden Kammer von oben durch die
darüber befindlichen Beschickungsöffnungen befeuert wird. Das Feuer auf dem Roste
r wird nun, da der Aschenraum desselben mit dem
Kanäle u und i verbunden
ist, mit heiſser Luft gespeist, kann aber auch, wenn es nothwendig wird, zugleich
durch Abheben der kleinen Glocke in der linken Nische der Einkarrthür mit kalter
Luft gespeist werden.
Von dem zweiten Schmauchkanale L über den Gewölben des
Ofens zweigen sich nach dem Ofen kleine Züge m ab, von
denen je drei nach den auf dem Ofen befindlichen Einfeuerungsöffnungen am Anfange
einer jeden Kammer führen. Diese Kanäle m können
mittels zweier über einander liegender Verschluſsglocken jeder einzeln abgesperrt
werden, so daſs der auf dem Ofen liegende Hauptschmauchkanal ganz isolirt ist.
Wenn nun alle 3 Schmauchsysteme in Thätigkeit gesetzt werden
sollen und z.B. Kammer 3 abgebrannt, Kammer 9 geschmaucht werden soll, so wird letztere durch Vorsetzen von
Schiebern von dem Ofen abgesperrt und die groſse Glocke r, welche der Kammer 9 Zug verschafft,
gezogen. Alsdann wird die in Kammer 3 in der rechten
Nische der Einkarrthür befindliche untere Glocke, welche den Schmauchkanal u vom Ofen absperrt, herausgenommen und die obere
Glocke wieder aufgedeckt; hierauf wird dieselbe (in Kammer 9 befindliche) Glocke herausgenommen und die obere wieder aufgedeckt.
Sofort entsteht ein Zug, welcher die Hitze aus Kammer 3
nach dem Kanäle w, von dort nach dem Kanäle i der Kammer 9 und aus
dieser nach dem Schornsteine führt. Mit dem oberen Schmauchsysteme über dem Ofen
tritt das gleiche Verfahren ein, nur mit dem Unterschiede, daſs dort bei Kammer 3 drei unter den obersten Glocken befindliche kleine
Glocken und bei Kammer 9 drei ebensolche Glocken
herausgenommen und die oberen Glocken wieder aufgedeckt werden. Die Hitze wird
dadurch aus Kammer 3 durch drei kleine Züge nach dem
Hauptschmauchkanale L, von diesem wieder durch die nach
Kammer 9 führenden Züge und aus dieser Kammer durch
Kanal d zum Schornsteine geführt. Dann wird auf dem
Roste r in Kammer 9
gefeuert, bis die Kammer abgeschmaucht ist.
Nach Rich. Müller in Eberswalde (* D. R. P. Nr. 32219
vom 18. December 1884) sind beim Ringofen zum Brennen
von Cement die einzelnen Kammern derart mit je einem
Gewölbe a (Fig. 10 bis 12 Taf. 34)
überspannt, daſs die Widerlager desselben die anstoſsenden Kammern abgrenzen. Diese
Widerlager b werden wieder durch ein Gewölbe c getragen, das eine Oeffnung d überspannt, durch welche die Feuergase ihren Weg zu den anstoſsenden
Kammern nehmen. Die in der Mitte jeder Kammer errichtete Scheidewand e trennt den unteren Theil jeder Kammer in zwei Theile
und wird zu der Höhe aufgeführt, bis zu welcher sich die einzelnen Cementarten beim
Garbrennen vom Gewölbe der Kammern aus senken.
A. Dufour in Dole, Frankreich (* D. R. P. Nr. 31932 vom
10. December 1884) will zum ununterbrochenen Brennen von Kalk, Cement oder Gyps einen Schachtofen
verwenden, welcher durch feuerfeste durchbrochene Platten o (Fig.
13 Taf. 34) in mehrere Abtheilungen u
geschieden ist. Zum Beschicken dienen die rings um den Schornstein S befindlichen Oeffnungen s. Die in den Feuerungen f entwickelten
heiſsen Gase streichen zunächst über Wasserbehälter m
und steigen durch die Löcher der Platten o bezieh. die
darauf lagernden Steine in die Höhe. Ist der auf den untersten Platten o liegende Kalk u. dgl. gebrannt, so zieht man diese in
geeigneter Weise aus einander, so daſs der Inhalt der unteren Kammer u in den Kanal k fällt.
Dann schiebt man die unteren Platten wieder zusammen, läſst die Füllung der darüber
liegenden Kammer u durch Auseinanderziehen der Böden
o herunterfallen u.s.f., bis schlieſslich die obere
Abtheilung durch Oeffnungen s wieder mit frischen
Steinen gefüllt wird. – Die Erhaltung der Platten o
wird nicht leicht sein.