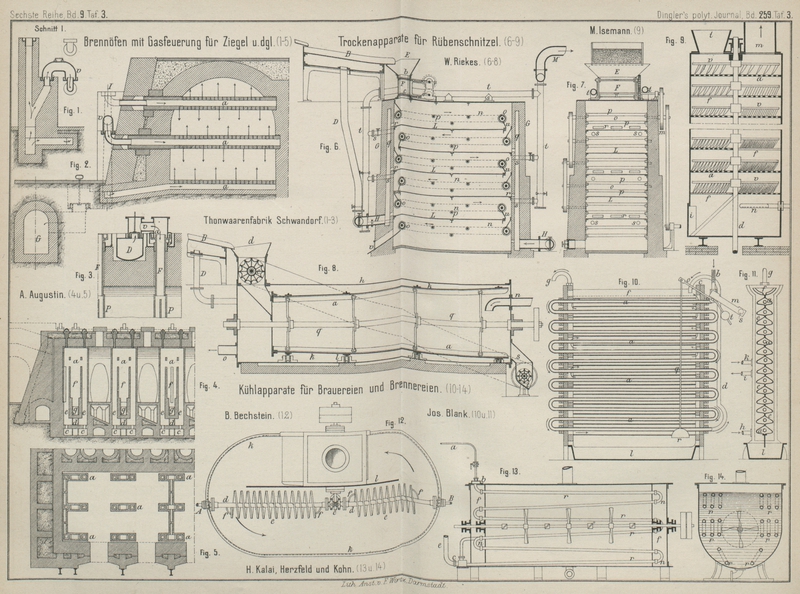| Titel: | Neuere Kühlapparate für Brennereien und Brauereien. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 39 |
| Download: | XML |
Neuere Kühlapparate für Brennereien und
Brauereien.
Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 3.
Neuere Kühlapparate für Brennereien und Brauereien.
B. Beckstein in Altenburg (* D. R. P. Nr. 32416 vom 4.
December 1884) will in die Vor Maischbottiche aus
Metall blech hergestellte hohle Schnecken einsetzen,
welche von kaltem Wasser durchflossen werden. Bei dem
sogen. Maischholländer ist z.B. in den mit Messertrommel versehenen Bottich k (Fig. 12 Taf. 3) eine
Scheidewand l eingesetzt, um den Umlauf der Maische in
der Richtung der angedeuteten Pfeile zu vermitteln. Auf der die Messertrommel
tragenden Welle ist eine Schraube ohne Ende c
angebracht, welche zur Drehung der Welle d dient, indem
sie in ein Schraubenrad eingreift. Durch die auf d
sitzende Hohlschnecke e flieſst von A nach B möglichst kaltes
Wasser. Die Welle d ist nur an ihren beiden Enden und
in der Mitte hohl und dienen die Röhrchen f, welche,
von der Durchbohrung der Welle d ausgehend, in die
hohle Schnecke e münden, zur Einleitung des Kühlwassers
in die letztere.
H. Kalai sowie Herzfeld und
Kohn in Budapest (* D. R. P. Nr. 33361 vom 23. April 1885) wollen Maisch- und Bierwürze unmittelbar durch Ammoniakgas einer Absorptionseismaschine kühlen.
Die Ammoniakgase treten durch Rohr a (Fig. 13 und 14 Taf. 3) in
den Vertheilungskörper b, gehen durch die Röhren r nach dem Sammelkasten c,
von wo aus sie durch das Ableitungsrohr e in den
Ammoniakgasapparat zurückkehren. Damit nun die bogenförmigen Verbindungen n, durch welche die Gase während der Kühlung ihren Weg
nehmen, noch möglichst ausgenutzt werden, sollen die Zwischenräume f mit einer Salzlösung gefüllt werden.
Bei dem aus Kühlrohren und Rieselflächen
zusammengesetzten Apparate von J. Blank in Heidelberg
(* D. R. P. Nr. 33367 vom 21. Mai 1885) liegen innerhalb der durch die wellenförmig
gebogenen Auſsenwände gebildeten Kanäle, durch welche das Kühlwasser strömt, an
ihren Enden durch Krümmer verbundene Röhren, welche die zu kühlende Flüssigkeit
zuerst durchflieſsen
muſs, ehe dieselbe zum Herabrieseln an den beiden Auſsenflächen des Apparates
kommt.
Das Kühlwasser durchflieſst die von den wellenförmigen Auſsenwänden gebildeten Kanäle
e (Fig. 10 und 11 Taf. 3) von
h nach i und
andererseits von k nach g.
Für die untere Abtheilung wird Eiswasser, für die obere Brunnenwasser verwendet. Die
zu kühlende Flüssigkeit tritt durch das Rohr b in das
oberste Rohr a und durchströmt schlangenförmig
sämmtliche Rohre a, bis sie schlieſslich unten aus
diesen in das Rohr d tritt. Durch hydrostatischen Druck
wird dieselbe nun in letzterem emporgetrieben und ergieſst sich bei c in die Pfanne f, deren
Boden mit zwei Reihen kleiner Oeffnungen versehen ist, durch welche dann die
Flüssigkeit auf die Seitenflächen des Apparates tritt und an diesen herabrieselt, um
sich in der Rinne l zu sammeln. Die Pfanne f ist doppelwandig und steht der hierdurch gebildete
Hohlraum mit dem zu oberst liegenden Kanäle e in
Verbindung. Das Kühlwasser tritt deshalb, nachdem es sämmtliche Kanäle e durchlaufen, schlieſslich in den Hohlraum der Pfanne
f und läuft bei g aus
diesem ab.
Um ein Ueberlaufen der gekühlten Flüssigkeit zu verhindern, ist das Küken des Hahnes
im Rohre b einerseits mit der Hülse m und andererseits mit dem Hebel o in feste Verbindung gebracht, so daſs dasselbe beiden
Theilen als Drehpunkt dient. In der Hülse m befindet
sich die Metallkugel s, welche, je nachdem die Hülse
die eine oder andere schiefe Stellung einnimmt, von der einen zu der anderen Seite
in derselben rollt. Der Hebel o ist durch ein Gelenk
mit der Stange q verbunden, an deren unterem Ende der
Schwimmer r befestigt ist. An dem anderen Ende des
Hebels o befindet sich zum Zwecke eines richtigen
Auswiegens der ganzen Vorrichtung das Gegengewicht t.
Bei geöffnetem Rohre b befindet sich der Schwimmer r nahezu am Boden der Pfanne l. Beim allmählichen Steigen der Flüssigkeit in letzterer wird auch der
Schwimmer in die Höhe gedrückt, wodurch dann in weiterer Folge die mit dem Hebel o gemeinsam an dem Küken des Hahnes befestigte Hülse
m aus der geneigten in eine mehr wagerechte und
endlich in die entgegengesetzte schiefe Stellung gebracht wird. Die in letzterer
befindliche schwere Metallkugel wird in Folge dessen von der einen Seite zu der
anderen laufen und nun vollends die Hülse nach dieser Seite hin niederdrücken, so
daſs in Folge dessen, da sich hierbei das mit der Hülse fest verbundene Küken des
Hahnes dreht, das Zufluſsrohr b abgesperrt wird. Der
Zufluſs desselben wird erst dann neuerdings beginnen, wenn man der Vorrichtung
wieder die erstere Stellung gegeben hat.
Tafeln