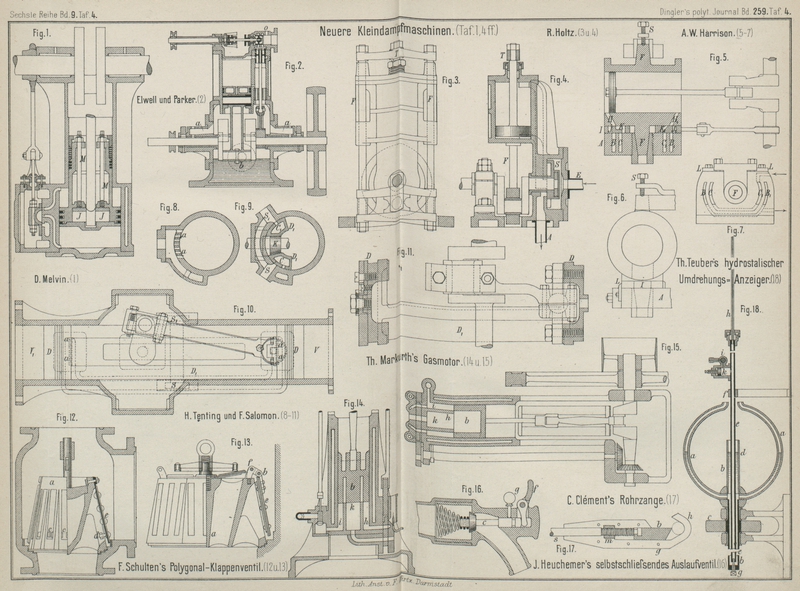| Titel: | Th. Markurth's Gasmotor. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 61 |
| Download: | XML |
Th. Markurth's Gasmotor.
Mit Abbildungen auf Tafel
4.
[Th. Markurth's Gasmotor.]
Bei der Gaskraftmaschine von Th. Markurth in Hamburg (*
D. R. P. Kl. 46 Nr. 32209 vom 9. October 1884) wird auſser dem Explosionsgemische –
getrennt von demselben – noch ein anderes, indifferentes Gas, z.B. Luft, derart in
den Cylinder eingeführt, daſs diese Trennung bis zum Augenblicke der Explosion
aufrecht erhalten bleibt. Es soll also zunächst die Explosion des Gasgemisches und
dann die Expansion der von letzterem erwärmten Luft nutzbar gemacht werden. Demnach
findet derselbe Vorgang wie beim Otto'schen Motor
statt, jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, daſs die indifferente Gasart bis
nach erfolgter Entzündung des Gemenges vom letzteren getrennt gehalten wird.
Fig. 14 und
15 Taf. 4
veranschaulichen die beiden Ausführungen des Motors in stehender und liegender
Anordnung. Das Cylinderende wird durch den Hohlkolben b
und einen ringförmigen Ansatz h am Cylinderboden in
zwei Räume i und k
geschieden. Beim Ausschube des Kolbens füllt sich der Raum i mit einem entzündbaren Gasgemenge und der Raum k mit Luft von etwa gleicher Spannung.
Ist der Kolben in der gezeichneten Stellung (etwa ⅓ seines Weges) angelangt, so
werden beide Zuführungsventile geschlossen und das Explosionsgemisch entzündet sich
in dem Augenblicke, wo die Verbindung zwischen den Räumen i und k hergestellt wird. Das
Explosionsgemisch verbrennt auf einmal vollständig, kann aber nicht mit zu groſsem
Stoſse auf den Kolben wirken, da das sich ausdehnende Gas Gelegenheit hat, nach dem
Raume k überzutreten; das nicht explodirbare Gas in k dient also als Luftbuffer; es wird zugleich dabei
stark erhitzt, hilft den Kolben mittreiben und zieht auch die zu hohe Temperatur der
Explosionsgase herab, wirkt also als Kühlmittel. Beim Rückgange des Kolbens stöſst
derselbe die verbrannten Gase aus, entweder vollständig wie in Fig. 14, oder zum
gröſsten Theile wie in Fig. 15.
Die Schiebereinrichtung ist die gewöhnliche. Man kann auch umgekehrt k als Explosionskammer und i als Behälter für das nicht explodirende Gas benutzen; auch kann man den
Raum k durch Aufsetzen eines inneren Ansatzes beliebig
verringern.
Tafeln