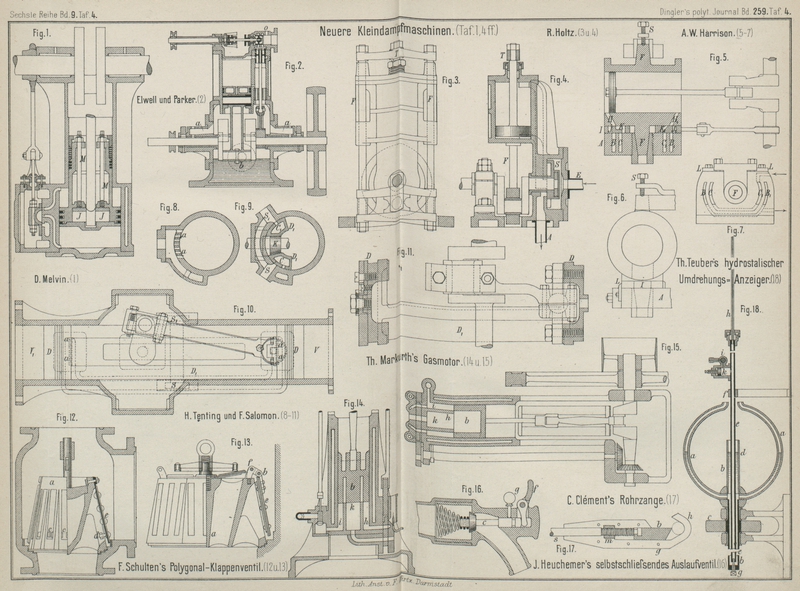| Titel: | Th. Teuber's hydrostatischer Umdrehungsanzeiger. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 61 |
| Download: | XML |
Th. Teuber's hydrostatischer
Umdrehungsanzeiger.
Mit Abbildung auf Tafel
4.
Th. Teuber's hydrostatischer Umdrehungsanzeiger.
Der hydrostatische Umdrehungsanzeiger, der zuerst von E.
Brown (1875 215 * 97) ausgeführt, später von O. Braun (1884 252 * 450)
abgeändert wurde und welcher auf der durch die Fliehkraft hervorgebrachten
Lagenveränderung einer eingeschlossenen Flüssigkeit beruht, wurde neuerdings durch
Th. Teuber an Bord S. M. S. Freya (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 30427 vom 2.
August 1884) dahin verbessert, daſs die Ablesung der augenblicklichen Umdrehungszahl
der Maschine, welche den Umdrehungsanzeiger bethätigt, auch in einiger Entfernung
von dem letzteren selbst erfolgen kann (vgl. R. John
1885 257 * 397) und daſs das Instrument selbst kleinere
Geschwindigkeitsänderungen noch deutlich angibt, was durch Anwendung zweier aus Quecksilber und Wasser bestehenden Flüssigkeitssäulen
erreicht wird.
Die beiden eisernen, halbkreisförmig gebogenen Röhren a
(Fig. 18
Taf. 4) sind in passender Weise mit der senkrechten, die Drehachse des Apparates
bildenden, aus zwei Theilen bestehenden Röhre b
verschraubt, welche zweimal gelagert ist und mittels einer Riemenscheibe c von der Maschine aus in Drehung versetzt wird. In die
Röhre b ist die gleichfalls aus Eisen hergestellte,
engere Röhre e geschoben, welche bei f festgehalten ist und durch die im Boden des Rohres
b sitzende Schraube g
Führung erhält; dieselbe trägt oben eine schwache Glasröhre h von geringem lichtem Durchmesser, hinter welcher sich die Eintheilung
befindet.
Die oben offenen Röhren a und b sind bis zur Marke d mit Quecksilber, die
Röhren e und h dagegen mit
Wasser oder Weingeist gefüllt. Durch die Umdrehung der Röhren wird in Folge der
Fliehkraft das Quecksilber in den Röhren a steigen, in
der Röhre b fallen und auch die Flüssigkeit in den
Röhren e und h und zwar in
viel stärkerem Maſse als das Quecksilber in b sinken.
Es wird deshalb eine deutliche Ablesung auf der hinter der Röhre h angebrachten Eintheilung möglich sein. Die
Eintheilung ist danach berechnet, daſs der Druck der Flüssigkeiten in den
senkrechten Röhren mit dem Quadrate der Umfangsgeschwindigkeit abnimmt. Hier ist
auch noch zu bemerken, daſs bei groſsen Umfangsgeschwindigkeiten die Kreisform der
Röhren a ausgleichend auf den Niedergang der
Quecksilbersäule im Rohre b wirkt. Je gröſser der
Höhenunterschied zwischen der Eintheilung und dem Quecksilberspiegel d ist, desto mehr müssen die Röhren b und e nach unten
verlängert werden. Zum Auffüllen der Röhre e dient der
kleine, mit derselben verbundene Cylinder k mit Hahn
L Der in dem Cylinder k angeordnete Kolben und die Schraube g am
unteren Ende des Rohres b regeln die Höhe des
Flüssigkeitsspiegels.
Besonders bemerkenswerth ist noch die von Teuber
vorgesehene Anwendung dieses Apparates zur Bestimmung der geographischen Breite. Wenn man nämlich den Apparat mit gleich bleibender
Umfangsgeschwindigkeit umlaufen läſst, so erhält man bei genügend genauer Ausführung
und möglichst groſser Uebersetzung der Aenderung des umlaufenden Flüssigkeitspiegels
ein Maſs für die Fallbeschleunigung in verschiedenen geographischen Breiten, oder
die Breite selbst.
Tafeln