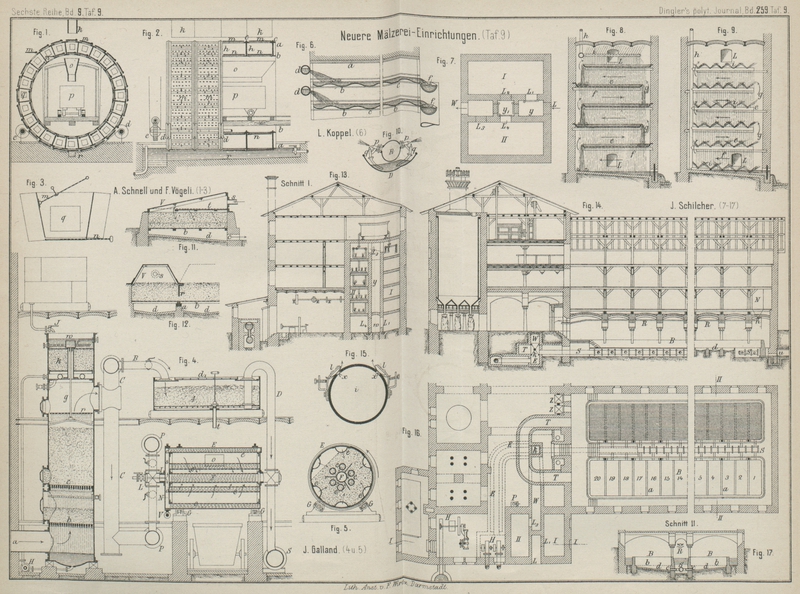| Titel: | Neuere Mälzereieinrichtungen. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 126 |
| Download: | XML |
Neuere Mälzereieinrichtungen.
Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 9.
Neuere Mälzereieinrichtungen.
Bei der Kühl- und Lüftungsvorrichtung für Mälzereien von
L. Koppel in Dresden (* D. R. P. Nr. 30177 vom 29.
Juni 1884) soll auf der einen Seite des zu kühlenden Raumes Luft durch einen mit
Lockfeuer versehenen Schornstein abgesaugt, die auf der anderen Seite eintretende
Luft aber durch Wasser abgekühlt werden. Der verwendete Kühlapparat besteht aus
einem guſseisernen Rahmen a (Fig. 6 Taf. 9), welcher
auf Winkeleisen c gewellte Bleche b trägt. Die Luft wird dem aus den Rohren d nach den Rinnen f
flieſsendem Wasser entgegen geführt.
A. Schnell und F. Vögeli in
Lochbach-Burgdorf, Schweiz (* D. R. P. Nr. 30625 vom 21. Februar 1884) verwenden zur
pneumatischen Mälzerei Kastenräder, welche sich
sehr langsam in unter denselben angebrachten Wasserbehältern drehen.
Zwei gelochte Blechringe a und b (Fig.
1 und 2 Taf. 9) werden durch Winkeleisen zu einem Doppelcylinder verbunden.
Vier solcher Cylinder bilden ein Kastenrad, dessen Winkeleisenreifen c auf den Rollen d der
beliebig angetriebenen Welle e laufen. Zwischen den
Ringen a und b befinden
sich Zellen, welche durch Blechwände h derart getheilt
sind, daſs deren immer vier neben einander in der Länge des Rades sich befinden. Ein
Trichter, der in 4 Theile k getheilt ist und über
welchem ein halbrundes Maſs hängt, ist dazu bestimmt, eine gewisse Menge Getreide in
die Zellen einzuführen. Die an dem Umfange über jeder Zelle angebrachten Deckel m (vgl. Fig. 3 Taf. 9) ermöglichen
das Oeffnen und Füllen bezieh. das Schlieſsen derselben. Auf dem Boden der Zellen
ist eine Klappe w, welche auf geeignete Weise geöffnet
und geschlossen werden kann, um die Zelle zu entleeren. Unterhalb der Zellen
befindet sich ein Trichter o, durch den die Körner,
welche aus den Zellen ausgelassen werden, zur bequemeren Fortbewegung in einen Wagen
p fallen. Aüſserdem sind an den Stirnflächen der
Zellen noch Schauöffnungen q angebracht, welche durch
einen Vorreiber geschlossen werden können. Das Kastenrad taucht unten in eine mit
Wasser gefüllte Rinne r.
Durch die Trichter k werden vom Boden vier Posten
Getreide in vier Zellen eingelassen und so fort, bis die Zellen sämmtlich gefüllt
sind. Das Kastenrad, welches etwa alle 3 Stunden eine Umdrehung macht, wird bei
seiner Bewegung das erforderliche Wasser aufgenommen haben. Sämmtliche Körner in
einer Zelle werden nun bewegt, ohne belastet zu sein, und die Keime werden nicht
beschädigt. Nachdem das Weichen 50 bis 60 Stunden gewährt hat, wird das Wasser
abgezogen und das Getreide dem Wachsthum überlassen.
J. N. Galland in Paris (* D. R. P. Nr. 32620 vom 10. Mai
1884) verwendet bei seiner pneumatischen Mälzerei zur
Anfeuchtung der Luft einen
Thurm, welcher auf Rosten b und c (Fig. 4 Taf. 9) Kokesfüllung enthält. Die vorher erwärmte Luft tritt
durch das Rohr a ein, steigt dem niederrieselnden
Wasser entgegen durch die Kokesschicht aufwärts und geht durch die Rohrleitung C in die das Getreide enthaltenen Behälter A und E.
Das erforderliche Wasser wird durch einen Hahn J in den
Behälter w gelassen, flieſst durch den Ueberlauf g zu dem Regenapparate r
und dann nach unten. Um das Wasser nochmals zu verwenden, hebt man es mittels der
Pumpe H unter das Filter k, durch welches es nach dem Behälter w
aufsteigt.
Auf dem Einweichbottiche A befindet sich ein Siebboden
d1. Das zu mälzende
Getreide wird in diesem Bottiche 48 bis 60 Stunden in Wasser geweicht. Wird das
Wasser aus diesem Bottiche entfernt, so beginnen bald nachher die Körner
aufzubrechen. Entgegengesetzt dem bisherigen Verfahren läſst man dieselben 2 bis 3
Tage ruhig liegen und verschlieſst während dieser Zeit den Einweichbottich luftdicht
mit einer Platte. Um die sich entwickelnde Wärme zu beseitigen, führt man den
Körnern frische Luft durch das Rohr B zu, welche durch
das Rohr D entweicht.
Das gekeimte Getreide fällt durch Trichter t und
Oeffnung o in die Trommel E (vgl. Fig. 5 Taf. 9). Diese besteht aus einem an beiden Enden geschlossenen
Blechcylinder. Die Scheidewand s ist mit Oeffnungen d versehen, mit welchen die aus Siebblech hergestellten
Kanäle e verbunden sind. Die bei I eintretende Luft gelangt von der Vorkammer N aus in die Kanäle E,
durchdringt das Getreide und wird durch das mittlere Siebrohr F und die Hauptleitung S
abgesaugt.
Die Trommel dreht sich beständig auf den Rollen G. Die
Bewegung selbst kann auf verschiedene Weise erzielt werden, z.B. wie in Fig. 4 durch
eine Schraube ohne Ende F, welche in einen Zahnkranz
eingreift. Während der nächsten 4 Tage nach dem Einbringen in die Trommel E wird den Körnern frische und feuchte Luft durch das
Rohr P, welches mit dem Kokesthurme in Verbindung
steht, aus diesem zugeführt. Sobald das Keimen sich verlangsamt, gibt man ungefähr 2
Tage lang den Körnern eine geeignete Mischung von frischer, feuchter und warmer,
trockener Luft; diese letztere kommt durch eine Oeffnung der Rohrleitung P aus einer Warmluftkammer.
Um die Bestandtheile der gekeimten Körner zu trennen, muſs man dieselben mit durch
Wasser gesättigter heiſser Luft erwärmen, ohne die Temperatur von 45 bis 50° zu
überschreiten, was den Anfang der Zuckerbildung der Stärkemehl haltigen
Bestandtheile des Getreides veranlaſst. Zu diesem Zwecke läſst man in die Trommel
E nur Luft aus der Warmluftkammer ein und bläst
durch den Hahn an dem Kreuzstücke L eine genügende
Menge Dampf ein, um die warme Luft bis zu der Temperatur zu sättigen, welche man in
der Kammer N wünscht.
Man läſst dann trockene Luft von 50° hindurchziehen und steigert die Temperatur
allmählich, bis das Malz fertig ist. (Vgl. Galland 1882
243 * 242).
Bei der von J. Schilcher in Graz (* D. R. P. Nr. 33131
vom 7. August 1884) in Vorschlag gebrachten Anlage zur
pneumatischen Mälzerei (Fig. 7 bis 17 Taf. 9) werden aus mit
Cement verputzten Mauerwerken Keimbecken B (Fig. 14, 16 und 17)
hergestellt und dieselben durch niedere Querwände a in
Abtheilungen d geschieden, welche Siebböden b erhalten. Die Horden sind lackirt und können zur
leichten Reinigung abgehoben werden. Jede. Abtheilung d
steht durch Rohr c mit dem Hauptthonrohre S in Verbindung. Dasselbe mündet in einen
Kreuzungskanal und kann je nach der Stellung der Klappe k (Fig.
14) mit den zu den Gebläsen H führenden
Kanäle E oder dem zum Wasserthurme führenden Kanäle W verbunden werden. Die oberhalb des Malzgutes in die
Keimtenne mündenden Kanäle T (Fig. 16) stehen je nach
Stellung der Klappe k mit dem Kanäle E, also dem Luftsauger, oder mit dem Kanäle W, also dem Luftreiniger, in Verbindung. Durch diese
Klappenanordnung ist es ermöglicht, die Luft je nach der Stellung der Klappe von
oben nach unten oder umgekehrt durch das Malzgut zu führen.
In der gezeichneten Stellung saugen die Gebläse H die
durch den Kanal W aus dem Luftreinigungsapparate
kommende Luft durch die Klappe k, die Kanäle T in den Tennenraum, von hier durch das Malzgut von
oben nach unten durch Rohr S nach dem Kreuzungskanale
durch die Klappe in den Kanal E. Die verbrauchte Luft
wird durch H ins Freie befördert. Wird die Klappe k in die punktirte Lage gebracht, so nimmt die Luft den
Weg von W durch k nach S, von hier durch das Malzgut von unten nach oben in
den Tennenraum, von diesem durch T, Klappe k nach Kanal E, somit zu
den Luftsaugern H und ins Freie. Der Ablauf des Wassers
durch den Hauptkanal, in welchem das Saugrohr S liegt,
wird gegen das Eindringen der äuſseren Luft durch einen Wasserverschluſs u (Fig. 14) versichert.
Die Fensterrahmen der Tenne sind von Eisen, in welche doppelte Scheiben, davon die
inneren von starkem violettem Glase, eingekittet sind. Die Eintrittsthür ist innen
von Eisen, auſsen von Holz, um einem Schwinden vorzubeugen, und an den
Aufschlagstellen mit Kautschuk abgedichtet. Den Auswurf des fertigen Grünmalzes
bezieh. des Schwelkmalzes bilden zwei mit dem doppelschaligen Aufzuge Z verbundene eiserne Sturzkästen, welche oben mit der
Sohle der Tenne abschlieſsen und in der Tenne durch Schieber, auſsen durch
selbstthätig schlieſsende Fallthüren, deren Aufschlagränder mit Kautschuk
abgedichtet sind, schlieſsbar und derart gestellt sind, daſs der Inhalt je eines
Sturzkastens in den darunter gestellten Kippwagen fällt und dieser durch den Aufzug
sofort nach der Darre gelangt.
An einer Stelle im Gewölbe, dem Auswurfe gegenüber, ragt ein Rohr n (Fig.
14) mit einer durchlochten Drosselklappe, an welches ein zweites Rohr
aufgeschoben werden kann, in die Tenne und stellt den Auslauf des Nachweichstockes
N dar, in welchen die geweichte Gerste aus den
Weichstöcken abgestürzt und bis zur Füllung der ersten Keimabtheilung aufbewahrt
wird. Das anzusteckende Rohr wird nach jener Keimabtheilung gerichtet, welche
gefüllt werden soll. Mitten durch die Längenachse der Tenne geht ein
Wasserleitungsrohr zur bequemen Reinigung der Tenne, dann eine Wasserrinne, über
welche ein Luftleitungsrohr R, das mit einer Luftpumpe
P in Verbindung steht und für jede Keimabtheilung
mit einem in Fig.
10 skizzirten Nebelapparate versehen ist.
Der Apparat zur Befeuchtung, Kühlung und Reinigung der
Luft besteht aus einem gemauerten, innen mit Cement geglätteten Thurme, in
welchen mehrere gelochte Zinkbleche derart liegen, daſs drei Seiten an die Wand
stoſsen, die vierte jedoch abwechselnd auf den Schmalseiten von der Wand absteht,
wie Fig. 8 und
9 zeigen,
so daſs die zu reinigende, unten eintretende Luft gezwungen ist, auf ihrem Wege zu
der oben im Thurme befindlichen Austrittsöffnung in Schlangenwindungen den von oben
herabrieselnden Wasserregen zu durchstreichen, wobei eine Reinigung der Luft von den
anhaftenden Staubtheilen u. dgl. bezieh. eine Kühlung und Befeuchtung erfolgt.
Bei der Anordnung Fig. 8 sind die gelochten Bleche e auf
Trägern f derart gelegt, daſs die Platten auf der
Schmalseite des Thurmes abwechselnd von der Wand entfernt bleiben und so die
Oeffnungen g frei lassen, durch welche die durch L eintretende Auſsenluft von einer in die andere
Abtheilung gelangt. Die Ränder der Zinkplatten e sind
aufgebogen, so daſs eine Art flacher Behälter gebildet wird, welche nach drei Seiten
mit der Thurmwandung durch Einmauerung fest verbunden sind, wodurch keine
Verschiebung der Bleche und somit auch kein Abblättern des Cementputzes und ein
Eindringen des Wassers ins Mauerwerk stattfinden kann. Das durch Rohr h eintretende Wasser wird durch das Siebrohr i zerstäubt und fällt als Regen theils durch die Siebe,
theils über den Rand derselben nach unten.
Bei der zweiten Anordnung Fig. 9 sind von dem
Hauptwasserrohre h Rohre i
abgezweigt mit etwa 5mm weiten Oeffnungen x (vgl. Fig. 15), aus denen das
Wasser austritt und durch stellbare Hauben l zerstäubt
wird. Durch zwischen den beiden Thürmen I und II (Fig. 7, 13 und 16) liegende Schächte ist
eine Verbindung derart hergestellt, daſs die bei L
(Fig. 7)
oben eintretende Auſsenluft im Schachte y niedersinkt,
durch L1 in den unteren
Theil des Thurmes I eintritt, hier, den Wasserregen durchstreichend, hochsteigt, bei
L2 in den Schacht
y1 tritt, hier
niedergeht, durch L4 in
den unteren Theil des Thurmes II eintritt, hier den Wasserregen nach oben
durchstreichend, bei L3
austritt und von hier durch Kanal W in gereinigtem
Zustande der Malztenne zugeführt wird.
Der Nebelapparat (Fig. 10) besteht aus an
das Rohr R geschraubten Düsen p, gegen welche unter einem passenden Winkel die Düsen q so eingestellt sind, daſs ein den Düsen p entströmender Luftstrom über die Düsen q wegstreicht und in Folge dessen durch letztere Wasser
aus der Rinne D angesaugt wird, wenn die mit q in Verbindung stehenden Röhrchen in das Wasser
eingelegt werden. Das Rohr R steht mit einer Luftpumpe
in Verbindung, welche die aus dem Kanäle W entnommene
gereinigte Luft mit einer Spannung von etwa 3at
durch die Düsen p austreibt. Das in feinen Tröpfchen
aus den Düsen q austretende Wasser wird durch den
Luftstrom in Nebelform über die Keimabtheilungen hinweggetragen und durch das
Keimgut mit der Luft gleichzeitig durchgesaugt.
Der Schwelk- oder Vordarrapparat wird dadurch gebildet,
daſs dasjenige Keimbett, in welchem das Grünmalz schon darrreif ist, von den übrigen
Abtheilungen durch einen bezieh. zwei Blechschieber r
(Fig. 11
und 12)
getrennt wird, auf dessen Rande, wie auch auf der Brüstung des Keimbeckens, eine
eiserne, mit an den Rändern eingelegtem Filze abgedichtete Verschluſsglocke V aufsitzt, welche durch einen kleinen Flaschenzug
leicht aufgehoben und herabgelassen werden kann. Diese Glocke steht durch ein
bewegliches Rohr s mit einem auſserhalb der Tenne
stehenden Heizapparate derart in Verbindung, daſs die erhitzte Luft in die Glocke
eintritt, sobald aus der mit der Glocke geschlossenen Abtheilung die Luft unterhalb
des Keimbodens durch Rohr c abgesaugt wird. Wird die
Luft durch das Malz umgekehrt von unten nach oben gesaugt, so bleibt für diese Zeit
und für die Schwelkfächer die Verbindung gegen das Saugrohr S (Fig.
14 und 16) geschlossen. In das Innere der Verschluſsglocke ragt eine Zunge t, damit die eintretende Luft zuerst zu der von der
Saugstelle entferntesten Stelle gelangt, um sich gleichmäſsig im Malzgute zu
vertheilen. Die in die Glocke tretende Luft soll nicht wärmer sein als 30°.
Vorausgesetzt, die Abtheilungen von Nr. 1 bis Nr. 20 wären mit
Keimgut gefüllt. Es wird nun die Glocke V von Nr. 20
gehoben, das Schwelkmalz auf die Sohle zur Entleerung durch die Sturzkästen
ausgeworfen, dann der freie Keimboden gut abgekehrt, der Blechschieber r gehoben, der Inhalt von Nr. 19 auf Nr. 20 mit
Heugabel und Schaufel geworfen, der Schieber r
niedergelassen, der freie Keimboden wieder nachgekehrt, dann Nr. 18 auf Nr. 19
gebracht u.s.w., bis dadurch Nr. 1 leer wird, in welche Abtheilung vom
Nachweichstock N gequellte Gerste abgelassen wird. Alle
2 Stunden wird Luft durch jede Abtheilung der Reihe nach von oben nach unten
gesaugt, ferner wird in jeder Abtheilung, sobald das in dem Keimgute steckende
Thermometer die für jede Abtheilung vorgeschriebene Höchsttemperatur anzeigt, so
lange Luft durchgesaugt, bis dasselbe auf die Mindesttemperaturanzeige
zurückgefallen ist. Bei sehr hoch aufgetragenen Haufen, 1m und darüber, können die unteren Schichten
bedeutend wärmer als die oberen werden und ist es dann nöthig, abwechselnd einmal
die Lüftung von oben nach unten, das andere Mal von unten nach oben durch einfaches
Umlegen der Kreuzkanalklappe k in die punktirte
Stellung vorzunehmen, wie dies oben erläutert wurde; diesfalls wird sich die
Temperatur rasch ausgleichen.
Je nach Bedarf setzt man aber, jedesmal während der Lüftung einer
Abtheilung, den für
dieselbe gehörigen Wassernebelerzeuger in Thätigkeit, wodurch dem Keimgute
mindestens so viel Feuchtigkeit wieder zugeführt wird, als durch die Lüftung sonst
entzogen würde. Dabei sieht man auf ein in der Mitte der Tenne hängendes Thermometer
und regelt den Zulauf des warmen Wassers im Winter, des kalten Wassers im Sommer zu
dem Wasserthurme so, daſs die Tenne die vorgeschriebene Temperatur hat.
Für das auf beschriebene Weise erzeugte Malz ist eine sorgfältige Vertrocknung
unerläſslich, weshalb die hier angewendete Trocknung vortheilhaft ist, um aus der
pneumatischen Malztenne ein Product fertig; zu liefern, welches auf jeder
gewöhnlichen Darre ohne besondere Schwelkvorrichtung abgedarrt werden kann.
Tafeln