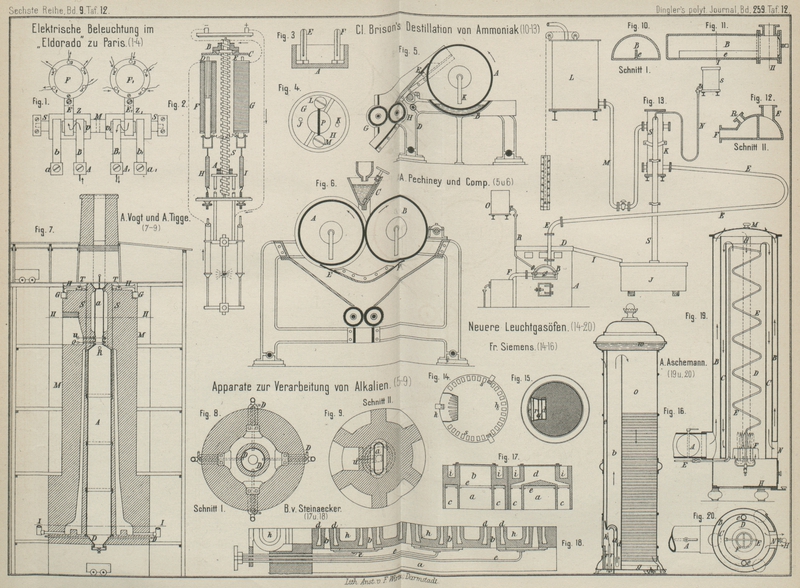| Titel: | Neuere Apparate zur Verarbeitung von Alkalien. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 175 |
| Download: | XML |
Neuere Apparate zur Verarbeitung von
Alkalien.
Patentklasse 75. Mit Abbildungen auf Tafel 12.
Neuere Apparate zur Verarbeitung von Alkalien.
Zur Darstellung von Alkalisulfaten werden nach A. Vogt und A. Tigge in
Westenhusen (* D. R. P. Nr. 34028 vom 1. Oktober 1884) Chlorkalium und
schwefelsaures Calcium fein gepulvert mit Magnesia innig gemischt, feucht geknetet
und dann getrocknet. Die dadurch entstandene poröse Masse wird in kleine Stücke von
möglichst gleicher Korngröſse gebrochen und sodann in den unten beschriebenen
Sulfat-Hochöfen bei Hellrothglühhitze mit überhitztem Wasserdampfe behandelt;
hierdurch wird alles Chlor als Chlorwasserstoff ausgetrieben und es verbleibt in dem
Ofen ein Gemisch von Kaliumsulfat, Calcium- und Magnesiumoxyd; die dabei als
Nebenproduct abfallende Salzsäure wird entweder als solche verflüssigt, oder in
einem mit der Abhitze des Hochofens geheizten besonderen Apparate nach bekannten
Methoden in Chlor verwandelt. Läſst man mit dem Wasserdampfe gleichzeitig Sauerstoff
eintreten, so soll die Salzsäure sofort in Chlor und Wasser umgesetzt werden.
In gleicher Weise soll auch Chlornatrium in Sulfat umgesetzt werden können, sowie
statt der Magnesia auch Kalk und statt des schwefelsauren Calciums auch
Magnesiumsulfat verwendet werden.
Der Zersetzungsapparat besteht aus einem mit
Generatorgasen heizbaren, in Fig. 7 bis 9 Taf. 12
veranschaulichten Hochofen. Die groſse Retorte A ist
aus einzelnen über einander gesetzten Guſseisenröhren zusammengesetzt; das unterste
Rohrstück enthält einen dicht verschlieſsbaren Stutzen zum Entleeren der
sulfatisirten Masse, auſserdem die zur Einströmung der Gase dienenden Rohransätze
D und ruht auf dem Mauerwerke, während das oberste
Retortenstück einen groſsen verschlieſsbaren Stutzen zum Füllen der Retorte und
einen Rohransatz R zum Entweichen der Gase enthält. Die
oberen Retortenrohre sind jedes einzeln besonders durch Stangen S, Hebel H und
Gegengewicht G mittels der auf dem Mauer werke M ruhenden Stützen T so
aufgehängt, daſs nur ein kleiner Theil ihrer Last auf das folgende untere Rohrstück
drückt, so daſs der Druck auf den Retortenuntertheil nicht zu stark wird. Der mit
Schiebern u und o
versehene Vorwärmer a ist wie die Retorte A ummauert und wird von der abgehenden Flamme geheizt.
Wenn behufs Sulfatisirung die Alkalichloride statt mit Wasserdampf allein mit
Wasserdampf und Luft behandelt werden und daher in den Oefen Chlor entwickelt wird,
so ist die innere metallische Fläche der Oefen oder Retorten durch ein
Silicatschmelz zu schützen.
Nach A. R. Pechiney und Comp. in Salindres, Frankreich (* D. R. P. Nr. 34040 vom 10. April 1885) wird zum Formen
von Aetznatron in feste Platten ein innen mit Wasser gekühlter Hohlcylinder
A (Fig. 5 Taf. 12) in Lagern
des Gestelles D langsam gedreht. Der Cylinder taucht
einige Centimeter tief in das mit geschmolzenem Aetznatron gefüllte Blechgefäſs B. Bei der Drehung bedeckt sich der Cylinder mit einer
festen Schicht von Aetznatron, welche, wenn sie bei der Umdrehung des Cylinders den
Kratzer E erreicht, von diesem losgelöst wird und
zwischen die Riffelwalzen G, H fällt, um hier in kleine
Stücke zertheilt zu werden, worauf sofort deren Verpackung erfolgt. Das zum Abkühlen
des Cylinders A bestimmte Wasser tritt an einem Ende
durch einen Hahn ein und am anderen Ende durch das Rohr K aus. Die Dicke der Natronschicht hängt von der Drehung des Cylinders A und von der Temperatur ab, auf welcher derselbe durch
den Wasserstrom gehalten wird.
Nach einem zweiten Vorschlage verwendet man zwei in entgegengesetzter Richtung sich
drehende Cylinder A und B
(Fig. 6
Taf. 12). Der Cylinder A ist an seinen beiden Enden mit
einem Rande versehen, zwischen welchem sich der Cylinder B bewegt. Ueber beiden Cylindern befindet sich ein Trichter C, der mit geschmolzenem Aetznatron gefüllt gehalten
wird und an seinem unteren Ende mit einem engen Längsschlitze versehen ist, durch
welchen das Aetznatron auf die beiden Cylinder niederflieſst. Die sich auf beiden
Cylindern bildende Schicht wird von den Messern E und
F losgelöst und fällt alsdann behufs Zerkleinerung
zwischen die darunter liegenden Riffelwalzen.
Tafeln