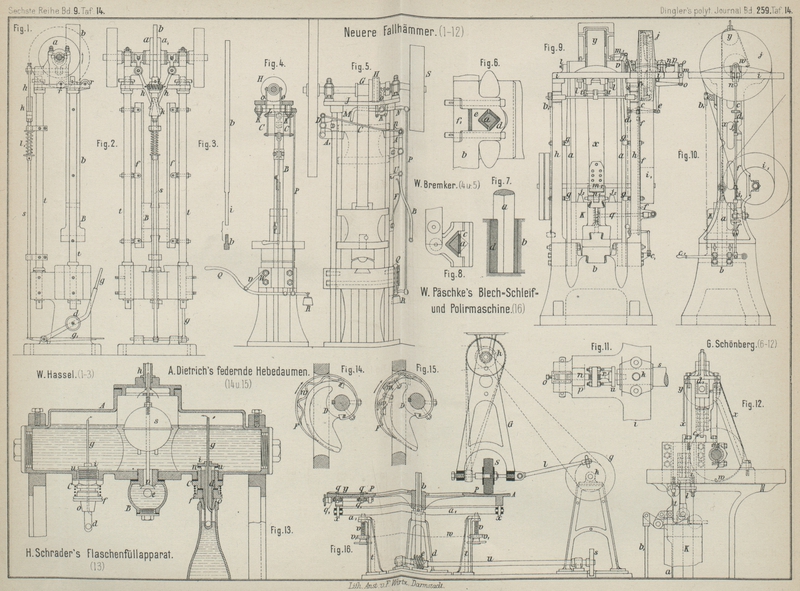| Titel: | H. Schrader's Flaschenfüllapparat. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 220 |
| Download: | XML |
H. Schrader's Flaschenfüllapparat.
Mit Abbildung auf Tafel
14.
H. Schrader's Flaschenfüllapparat.
Bei der von H. Schrader in Hamburg (* D. R. P. Kl. 64
Nr. 33137 vom 21. Februar 1885) angegebenen Vorrichtung zum Abziehen von
Flüssigkeiten aus Fässern und anderen geschlossenen Gefäſsen in Flaschen erfolgt die
Bewegung der Flüssigkeit unter Abschluſs der
Auſsenluft, indem die aus den Flaschen bei ihrem Füllen verdrängte Luft in
das Faſs übertritt. Dabei regelt ein Schwimmer die Menge der in den Füllapparat
eintretenden Flüssigkeit.
Ein von Ständern getragener Behälter A (Fig. 13 Taf. 14) steht
durch einen Gummischlauch und den Stutzen e mit dem
Abzapfhahne des Fasses in Verbindung. Durch e tritt die
abzuziehende Flüssigkeit unterhalb des an einen Schwimmer s gehängten Ventiles v in den Raum B ein und füllt den Behälter A bis zu einer bestimmten Höhe, worauf durch den Schwimmer das Ventil v geschlossen und der weitere Zulauf abgesperrt wird.
In dem Behälter A befinden sich nach abwärts gerichtet
Verschraubungen C, in denen die cylindrischen
Abzapfröhren d eingeschliffen verschiebbar stecken. Auf
der Verlängerung von d ist eine Mutter f befestigt, unterhalb welcher ein kegelförmiger
Gummiring o um das Rohr gelegt ist, welcher die zu
füllenden Flaschen an ihren Mündungen abdichtet. Zwischen den Verschraubungen C und den Muttern ist eine Spiralfeder angebracht, wodurch die Abzapfröhren
d, welche oben den vorspringenden Rand i besitzen, auf die zugehörigen Verschraubungen
niedergehalten werden. In diesen niedergedrückten Stellungen sind die Abzapfröhren
nach auſsen hin durch die Gummiringe u abgedichtet.
Sobald man eine Flasche mit der Mündung über den Ring o
schiebt und die Flasche hebt, kann aus dem Behälter A
Flüssigkeit durch die Abzapfröhre d austreten, indem
letztere oben unterhalb u mit seitlichen Durchbohrungen
n versehen ist. Es füllt sich nun die Flasche,
wobei die Luft aus derselben durch ein innerhalb d
gelagertes, bis unter die Behälterdecke reichendes Röhrchen g in den Behälter A übertritt. Von hier geht
die Luft durch den Ansatz h und mit Hilfe eines
Gummischlauches o. dgl. in das Faſs über.
In Fig. 13
befinden sich die zu füllenden Flaschen in senkrechter Stellung. Der Apparat wird
für schäumende Flüssigkeiten so eingerichtet, daſs die
Flaschen geneigt zu stehen kommen und, indem die Flüssigkeit dann gegen den
Flaschenhals ausströmt, das Füllen ohne störende Schaumbildung vor sich geht. (Vgl.
Schlicht und Broedemann u.a. 1884 251 * 113.)
Tafeln