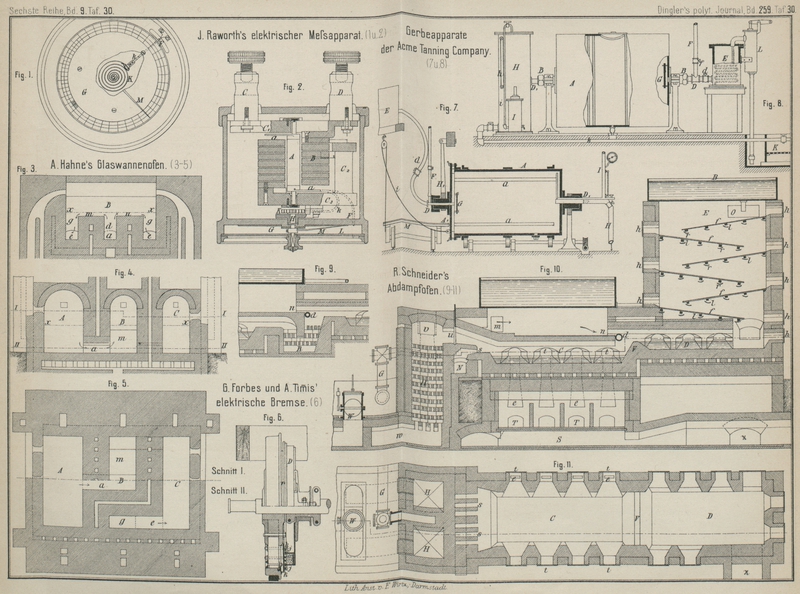| Titel: | G. Forbes und J. A. Timmis' elektrische Bremse. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 456 |
| Download: | XML |
G. Forbes und J. A. Timmis' elektrische
Bremse.
Mit Abbildung auf Tafel
30.
Forbes und Timmis' elektrische Bremse.
Während Achard (vgl. 1879 233
* 379) bei der neuern Form seiner elektrischen Bremse für Eisenbahnzüge von der
Radachse aus mittels zweier Reibungsscheiben eine andere Achse, welche einen zur
ersteren parallelen vierpoligen Elektromagnet trägt, in beständige Umdrehung
versetzt und dieser Elektromagnet, wenn ein Strom denselben durchläuft, zwei zu
beiden Seiten des Elektromagnetes angeordnete eiserne Scheiben anzieht und dadurch
mit in Umdrehung versetzt, so daſs die mit den Scheiben verbundenen, aber lose auf
dieselbe Achse aufgesteckten Muffen sich mit drehen und dabei die Bremsketten
aufwickeln und die Bremse in Thätigkeit versetzen, lassen G.
Forbes und Illius A. Timmis in London (* D. R.
P. Kl. 20 Nr. 33634 vom 9. Mai 1885) die Elektricität in verwandter Weise mehr
unmittelbar bremsend wirken. Sie bringen nämlich, wie aus Fig. 6 Taf. 30
ersichtlich, an dem auf der zu bremsenden Wagenachse ersichtlichen Rade oder an
einer besonderen auf dieser Achse aufgesteckten Scheibe auf der einen Seite einen
flachen, glatt abgedrehten Ring r aus einem
magnetisirbaren Materiale an und stellen dieser Radfläche eine ebenfalls aus
magnetisirbarem Materiale (vorzugsweise aus weichem Eisen) hergestellte Scheibe D gegenüber, deren Nabe die Radachse lose umgibt,
während die Scheibe in geeigneter Weise an dem Untergestelle des Wagens befestigt
ist, sich also nicht mit der Achse drehen, wohl aber sich ein wenig auf der Achse
hin und her verschieben kann. Diese Scheibe D bildet
ein ringförmiges einerseits offenes Gehäuse und in diesem ist eine
Elektromagnetspule in paralleler Lage zur Achse so angebracht, daſs ein sie
durchlaufender Strom das Gehäuse magnetisch macht. Vor der dem zu bremsenden Rade
zugewendeten Oeffnung des Gehäuses sind Ringe j und zu
beiden Seiten desselben und dem Rade etwas näher stehend, sind andere Ringe k aus gehärtetem Walzstahl von etwas federnden Haltern
angebracht, welche bei normaler Lage der Bremse ein wenig gegen den Ring r an der Fläche des Rades geneigt sind. Durch die
magnetische Anziehung werden die Ringe k bremsend gegen
das Rad gezogen und die stärkste Bremswirkung tritt ein, wenn auſser diesen Ringen
auch die zwischen ihnen liegenden Ringe j an die
Radfläche angedrückt werden. (Vgl. Amberger 1875 216 * 405. Kämpfe 1885 255 * 23.)
Tafeln